Akzeptanz neuer Technologien Fortschritt braucht Innovationen sollen das Leben einfacher, günstiger, nachhaltiger werden lassen. Während sich die eine Hälfte von Gesellschaft und Wirtschaft gern ins Technologie-Abenteuer stürzt, schaut die andere lieber erstmal zu. Beide Seiten haben gute Gründe. Forderung nach einheitlichen Akku-Tests für E-Autos Sammelverfahren im VW-Abgasskandal
Früh übt sich...
|
Öffentlicher Dienst: Lehrer in Ketten(12.03.2015) Kein Ergebnis bei der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder am Freitag. Nun drohen Streiks. In Rheinland-Pfalz wird heute gestreikt. Auch angestellte Lehrer machen mit. Denn bei ihnen herrschen anscheinend große Ungerechtigkeiten. Das zeigt ein Beispiel aus Koblenz. Wenn Grundschullehrerin Claudia Fligg Unterricht hält, will sie zuhören, den Kindern etwas beibringen und bei allem, was sie macht, mit Schule eine Freude machen. O-TON Claudia Fligg, Angestellte Grundschullehrerin: „Spaß ist das A und O. Wenn Kinder keinen Spaß an der Schule und am Lernen haben, lernen sie nicht. Egal, wie intelligent sie sind.“ Ihr eigener Spaß am Lehrerdasein wurde ihr lange Zeit verdriest. Fast acht Jahre lang. Solange erhielt Claudia Fligg immer nur befristete Verträge. In Deutschland geht es mehr als 30.000 Lehrern genauso. Immer zu den Sommerferien heißt es bei vielen: sich arbeitslos melden und auf den neuen Vertrag hoffen. Wertschätzung? Fehlanzeige, wirkt eher wie Note sechs. O-TON Claudia Fligg, Angestellte Grundschullehrerin: „Nicht für mich sondern auch für meine Familie und meine Freunde, die konnten alle das Thema nicht mehr hören, weil ich immer wieder Ängste hatte oder werde ich irgendwo anders hingesetzt.“ Im vergangenen Sommer endlich die Festanstellung hier an der Grundschule Rohrerhof in Koblenz. Vorgestern ging ihre Probezeit zu Ende. Doch immernoch leidet ihre Leidenschaft für den Lehrerberuf. Denn Claudia Fligg ist wie 200.000 Lehrkräfte angestellte Lehrerin, keine Beamtin. Beide Gruppen haben zwar das gleiche Grundgehalt. Doch Claudia Fligg muss die Beiträge zur Sozialversicherung selbst bestreiten. Auch ihre Rente wird später viel niedriger ausfallen als die Pension der verbeamteten Kollegen. Die erhalten zudem Zuschläge für Ehe und Kinder oder einen Zuschuss zur Krankenversicherung. So gibts für angestellte Lehrer oft 500 Euro weniger im Monat als die Beamten im Kollegium. O-TON Claudia Fligg, Angestellte Grundschullehrerin: "Wir haben alle die gleiche Ausbildung. Das wird ja in manchen Dingen vorgeschoben. Ich habe aber das Studium und Referendariat genauso gemacht. Da gibt es für mich überhaupt keine Begründung, dass ich weniger Geld bekomme. Und auch in der Rente weniger bekommen werde. Und auch länger arbeiten muss, und, und, und." GMM - Das Wirtschaftsmagazin MikrokrediteWarum wollen Sie, verehrter Hörer, denn eigentlich keine Bank werden? Und eine gute obendrein, die Menschen hilft? Ja, das geht relativ einfach. Mit Mikrokrediten. Sie legen 100 Euro an. Mit diesem Geld kann in Entwicklungsländern schon eine Kuh gekauft werden. Oder neues Saatgut. Und durch den Ertrag bekommen Sie Ihr Geld wieder zurück. Sie glauben das nicht? Der Banker Muhamad Yunus bekam dafür den Friedensnobelpreis, die UN rief sogar das Jahr 2005 zum Jahr der Mikrokredite aus. Also muss doch was dran sein? (13.09.2008) Tanzlied der Tigwa Manobo, (M0-022134 003) LC: 06356 WELTMUSIK Die Philippinen. Sie gehören zu den vier aufstrebenden Pantherstaaten – also zu den Ländern auf dem Sprung zu einem Industriestaat. Sie eifern damit ihren Nachbarn, den Tigerstaaten wie Südkorea nach. Die Philipinen sind arm. Trotzdem spielen auch hier Bioprodukte für die kleine, aber reiche Oberschicht eine immer größere Rolle. Die Nachfrage ist da. Aber das Angebot kann nicht gestillt werden. Nicht weil es zu wenige Bauern gäbe, die Bioreis und Bio-Zucker anbauen. Es fehlt an den Vertriebswegen. Das erkannten Kleinbauern aus dem Umland von Manila und wollten eine Handelsorganisation gründen. Ein paar hundert Euro reichten schon. Nur: Sie hatten kein Geld, keine Sicherheiten. Was ihnen half war ein Mikrokredit aus Deutschland, vermittelt durch Oicokredit – einer Genossenschaft, an der mehr als 4000 Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Anteile gezeichnet haben. Manuela Waitzmann: „Ab 200 Euro sind sie dabei. Dieses Geld läuft dann als Kredit auf die Philipinen – oder auch nach Peru, Indien oder auch nach Afrika – Dort wird es eingesetzt für Handelsorganisationen wie auf den Philipinen oder zur Förderung einer Kaffeegenossenschaft in Lateinamerika. Da gibt es inzwischen über 700 Partnerorganisationen.“ Hans-Peter Burghof: „Das eine ist, dass sie damit ihren institutionellen Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten bieten kann, die ganz stark abweicht von anderen Zahlungsprofilen, die möglich sind. Das nennt man dann Diversifikation. Zum anderen denke ich, dass man bei der Deutschen Bank auch sagt: ‚Das ist ne tolle Idee, hier bauen wir Strukturen auf und vielleicht – wer weiß – in zehn, 20 Jahren wird in diesen Ländern auch richtiges, erfolgreiches, effizientes Bankgeschäft möglich sein.’“ Und tatsächlich: Im Moment sind Mikrokredite am Laufen über ein Gesamtvolumen von rund 17 Milliarden Euro. Der Bedarf, schätzen Experten, umfasst das Zehnfache. Kleinvieh macht auch Mist. Und daran wollen auch die großen Banken teilhaben. Lukrativ das ganze auch wegen der lokalen Kreditwesens. Die Zinsen sind wegen der meist hohen Inflation sehr hoch. Genügend Spielraum für Rendite. Aber dazu gehört auch hohes Risiko und Aufwand, meinen Manuela Waitzmann und Hans-Peter Burghof: „Dann kommt dazu, dass diese Kleinkreditvergabe ein sehr arbeitsaufwendiges und damit teures Geschäft ist. Sie haben bei Kleinkrediten einen großen Begleitungsbedarf. Die Leute sind unterwegs, sie sind vor Ort.“ „Man braucht immer einer Entwicklungsorganisation dahinter, die hilft die Leute zu schulen. All’ das ist natürlich sehr teuer, und kann aus diesem Mikrokredit-Geschäft nicht finanziert werden.“ Aber immerhin: Zwei Prozent Rendite verspricht Oikokredit demjenigen, der die Genossenschaftsanteile zeichnet. Nicht so viel wie auf einem Sparbuch, aber immerhin finanziert der Geldgeber kleine Projekte und Ideen, die die Welt besser machen. Und die Bauern auf den Philippinen freuen sich über bessere Geschäfte. Ihren Kredit haben sie mittlerweile zurückgezahlt. GMM - Das Wirtschaftsmagazin Der Verbraucher als SpekulantDie Informationsflut unserer Zeit führt dazu, dass der Verbraucher viel mehr darüber weiß, welche globalen Ereignisse sich wie auf seinen Geldbeutel auswirken. Gleichzeitig hat er dank Globalisierung ein noch größeres Angebot. In diesem Dschungel von ständig variierenden Preisen, verlockenden Angeboten und immer weniger Geld im Portemonnaie bleibt ihm nur noch eins: Spekulieren. JASOfm hat nach den Folgen gesucht und sie unter anderem bei einem Heizöllieferanten gefunden. (30.08.2008) ATMO am Empfang, Früher war das noch ein ruhiger Job. Aber heute hat Ruth Gohr wahrhaftig beide Hände voll zu tun. Die eine an der Computermaus für die Telefonanlage, die andere Hand am PC, der ihr mit der Postleitzahl des Kunden verrät, wer der richtige Ansprechpartner im Hause ist. ATMO 2 „Sie würden gerne Heizölbestellen? Ich verbinde sie! Firma Friedrich Schaar, mein Name ist Gohr ... Guten Tag! Dideldelie“ Alle Anrufer wollen wissen: Wie hoch ist der aktuelle Ölpreis bei ihrem Händler. Und sie alle spekulieren. Dass der Ölpreis fällt, sie mehr fürs selbe Geld bekommen. Geschäftsführer Günter Bölle weiß ab und zu nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Günter Bölle. „Wir haben Verbraucher, die bis zu ihrer Bestellung sicherlich 20 Mal anrufen. Für uns heißt das heute, dass das Geschäft immer schwieriger wird. Wir brauchen heute einen viel größeren Aufwand. Wenn 20 Mal ein Kunde anruft, sind das 20 Gespräche, die wir mit einem Kunden führen. Das sind sicherlich mehr als das Doppelte wie in der Vergangenheit.“ Die Alternative: Einkaufsgemeinschaften. Zusammen kaufen macht es für den einzelnen billiger. Doch in dieser Zeit, in dem der Ölpreis sich ständig verändert, und das auf hohem Niveau, scheiden sich auch oft genug die Geister am richtigen Zeitpunkt für den Einkauf: Günther Bölle: „Langjährig bestehende Einkaufsgemeinschaften bröckeln plötzlich auseinander, weil unterschiedliche Meinungen zum Markt da sind bei den Kunden und der eine macht einfach nicht mit und sagt: ‚Ich kauf mein Heizöl später.’“ ...und schon wars das mit der Gemeinschaft. Schuld die Kritik des einen an der Spekulation des anderen. Schließlich kostet eine Heizöllieferung schnell mehrere tausend Euro. Aber es ist auch Öl in kleinen Mengen, das den Verbraucher zum Spekulanten werden lässt. Frau: „Ha, wenn der Sprit billiger ist, tanke ich natürlich mehr. Wenn ich sehe, er ist über Einsfünfzig dann gucke ich natürlich, dann tanke ich nur für 20 Euro in der Hoffnung, dass er die Woche drauf günstiger ist.“ Spekulationen aller Orten. Weniger tanken in der Hoffnung, das nächste Mal billiger wegzukommen. Die Folge: Nicht nur die Benzinpreise sind sprunghaft, auch das Kundenverhalten. Und dieses Geräusch... ATMO Zapfpistole ... wenn der Tank voll ist, hört Tankstellen-Chef Helmut Fischer immer seltener. ATMO Tanksäule, dann Helmuth Fischer: „Wir haben viele 10-Euro-Tanker. Wir haben zwar fast den gleichen Umsatz. Aber dadurch wesentlich mehr Stress an der Kasse als im Normalfall. Wenn also der Preis unten ist, dann tanken die Leute voll, weil sie sagen, sie warten drauf, bis der Preis wieder runtergeht. Und wenn der nur drei oder vier Cent runter ist, dann haben wir hier auch wieder die Hölle, weil dann kommt alles rein. Dann ist die Straße zu, dann ist ein Gehupe und ein Gemecker hier im Hof, da geht nichts mehr vorwärts, Alle drei Kassen werden in Anspruch genommen. Da heißt es also schon Gas geben bei uns hier.“ Geiz allein war gestern. Heute kommt der richtige Riecher hinzu, wo der Handyvertrag am längsten am billigsten bleibt oder welche Energiequelle in Zukunft am meisten gefördert wird. Spekulieren auch beim Autokauf. Welche Gemeinde lässt bald welche Umweltplaketten passieren? Kostet Diesel in Zukunft gleich viel wie Benzin? Oder fahre ich besser mit Gas? Die Politik feuert des Verbrauchers Spekulationen weiter an, ärgert sich Reimund Elbe vom ADAC. Zum Beispiel in der Frage, ob Autos weiter nach Hubraum oder Co2-Ausstoß besteuert werden: Reimund Elbe: „Der Autofahrer heute ist ein Spekulant, denn es gibt noch keine Planungssicherheit für die Autofahrer. Die ganze Welt diskutiert hier über das Thema Co2-Ausstoß und hier kann man ganz einfach mit einem gesetzgeberischen Mittel eingreifen und man tuts nicht, weil man da einfach in diesem Gesetzgebungsprozess viel zu lang braucht.“ Der Verbraucher, gezwungen zum Spekulieren von Markt und Politik: Das Problem wird weiter zunehmen, sagen Experten. Immer mehr Angebot wird für immer mehr Dickicht sorgen. Der Fluch der Möglichkeiten. Dagegen hilft nur eine alte Börsenweisheit: Sich soweit es geht informieren. Und dann nach Gefühl handeln. Report Mainz berichtet Sterbehelfer Roger Kusch holte sich Anregungen beim umstrittenen Sterbehilfeverein DIGNITAS(07.07.2008) Roger Kusch hält schon seit Jahren Kontakt zu Ludwig A. Minelli. Dabei habe es einen Gedankenaustausch zwischen ihm und Minelli gegeben, sagt Kusch. Und das, obwohl die vor zehn Jahren gegründete Sterbehilfeorganisation DIGNITAS immer wieder in der Kritik steht. Unklare Geldflüsse, Sterbebegleitung im Schnellverfahren und Sterbehilfe auch bei Patienten, die gar nicht unheilbar krank waren. Das lässt Roger Kusch unbeeindruckt: O-TON Roger Kusch: „Das ändert bis zum heutigen Tage nichts an meiner Hochachtung für Minelli persönlich, während die allermeisten Menschen immer nur reden, kluge Worte finden, nachdenkliche Gedanken, aber nichts passiert, gehört Minelli zu den ganz wenigen Menschen, die konkret helfen“ Anders sehen das die Schweizer Behörden: Die Gesundheitsdirektion Zürich droht Ärzten mit aufsichtsrechtlichen Konsequenzen, sollten sie das todbringende Medikament Natriumpentobarbital wie bisher Patienten verschreiben, für die es noch Therapiemöglichkeiten gibt. Bettina Schardt aus Würzburg wäre so eine Patientin gewesen. Die 79 Jahre alte Rentnerin ging vor gut einer Woche mit Hilfe von Roger Kusch in den Freitod – obwohl sie therapierbar gewesen wäre. Wie das ARD-Fernsehmagazin Report Mainz jetzt aufdeckt, war sie seit 2002 bei DIGNITAS Mitglied, wollte offenbar mit DIGNITAS in den Tod gehen. Das bestätigt Soraya Wernli, ehemalige Mitarbeiterin von Dignitas: O-TON Soraya Wernli: „Zu diesem Zeitpunkt, als sie sich jetzt Ende Februar Ende März bei Dignitas gemeldet hat, konnte und durfte ihr ein Dignitas Arzt kein Rezept mehr ausstellen. Bettina Schardt hat keine terminale Erkrankung. Somit hätte sie keine Chance gehabt.“ Roger Kusch machte den Freitod mit Medikamenten schließlich doch möglich und erledigt damit offenbar die Arbeit der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas in Deutschland. Kusch macht mittlerweile auch massiv Werbung für seinen neugegründeten Verein „Doktor Roger Kusch Sterbehilfe e.V.“. Manchmal wirkt das wie gezielte Akquise: Dem schwer krebskranken Bernd Bremer schickte Kusch unaufgefordert einen Werbebrief für seinen Verein „Kusch Sterbehilfe e. V.“. In dem von Kusch unterzeichneten Schreiben spricht sich Kusch aus für „Selbstbestimmung am Lebensende“ und „gegen Sterbetourismus in die Schweiz“. Bernd Bremer bekam den Brief nur weniger Tage nach seiner Diagnose: O-TON Bernd Bremer: „Das ist eine ziemlich brutale Angelegenheit, ziemlich brutal muss ich sagen. Und es ist furchtbar, was das mit einem macht. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Man empfindet das wie so ein Todesurteil. Das ist die Bestätigung jetzt.“ Von Reportern des Fernsehmagazins Report Mainz mit diesem Fall konfrontiert, zeigt sich Roger Kusch überrascht, weißt jede Verantwortung von sich: O-TON Roger Kusch: „Ich habe noch nie geworben für den Verein, ich werde für den Verein nicht werben. Ich werde auch nicht für mich persönlich werben.“ Warum der Brief doch an einen schwer krebskranken geschickt wurde, und das ausgerechnet wenige Tage nach dessen Diagnose, bleibt ein Rätsel. Klar ist, dass die Enthüllungen rund um den von Medien zum Todesengel getauften Roger Kusch in den nächsten Tagen weiterhin für Aufsehen sorgen werden. Stadt der Gegensätze: BrüsselBei Brüssel fällt mir als erstes das Atomium ein, dieses riesige Edelstahl-Konstrukt in Form eines Eisenmoleküls. Aber Brüssel hat noch viel mehr zu bieten. Es ist eine romantische, aber auch abwechslungsreiche Stadt und deshalb ist Brüssel heute unsere Wochenend-Reisetipp. Denn in gut drei Stunden ist man mit dem Auto oder dem Zug in der europäischen Hauptstadt. SWR4-Reporter Juri Sonnenholzner hat sich auf den Weg gemacht und traf sich zuerst mit einem Dreikäsehoch. (12.04.2008) ATMO Wassergeplätschel Er steht einfach da und pinkelt. Und dafür erhält er tagein tagaus die Aufmerksamkeit von Millionen Touristen: Männeken Piss, die gerademal einen halben Meter hohe Bronzefigur in der Brüssler Altstadt. Micheline Dooms führt seit gut 20 Jahren den Kiosk schräg gegenüber und hat den, der ihr Kunden verschafft, immer im Blick. O-TON OVER Micheline Dooms: Nicht weit weg von Männeken Piss ist die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt: die Grand Place mit gotischem Rathaus, Stadthäusern, Cafés und Hotels. An Wochentagen gibts hier einen Blumen-, sonntags den Vogelmarkt statt. Einen Trödelmarkt gibt es jeden Tag im Quartier des Marolles, dem bunten und volkstümlichen Stadtviertel. Die Bewohner sind Brüsseler Urgesteine, so wie Nicole Calmes aus dem Antiquitätengeschäft Ott Ontieque 207 an der Hoogstraat. O-TON Jutta Kremer Es gibt noch mehr zum Dick werden gleich nebenan: Die Fressgasse Rue des Bouchers. Gastronomie in Brüssel – das heißt rund 2000 Gaststätten mit einer im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Anzahl hochklassiger Lokale. Eher bodenständig kocht Antoine – Pommes, mit riesen Erfolg! O-TON OVER "Unser Haus gibt es seit 60 Jahren. Von je her bereiten wir die Kartoffeln und Soßen hier zu und machen sie selbst zu Pommes frites. Und natürlich das hohe Qualitätsniveau - das alles hat Einfluss auf unseren Erfolg." Und bei Antoine um die Ecke ist Europa. Das Europaviertel. Schön ist es nicht, aber beeindruckend. Wie ein auf ein Riff gefahrenes Kreuzfahrtschiff baut sich das Europäische Parlament über dem Viertel auf, darunter das kleine Schlößchen der bayerischen Landesvertretung in einer Talsenke. Hässliche Wohnklötze stehen Wand an Wand mit verträumten Jugendstilhäusern, auf dem Prachtboulevard Louise hat der Gehweg Löcher. Krasse Gegensätze – auch das ist Brüssel. Aber einen kleinen Mann stört das gar nicht: Munter macht er weiter das, wofür er berühmt wurde. Manneken Piss macht Pipi ohne Unterlass. ATMO Wasser Zu Gast im Ameisennest(23.03.2008) A 1 O 1 „Wir sind hier... wir gehen da jetzt mal ran“ Nix ist los. Tote Hose. Und der Staat ist nur ein Haufen. Nicht prachtvoll, aber hochkomplex. Bloß ich seh davon nichts. Kein Krabbeln. Kein Sammeln. Nix Königin gucken. O 2 „... kleine, rote, kahlrückige Waldameise.“ Diese kleine, rote, kahlrückige Waldameise bleibt versteckt. Tief unten, zwei Meter unter der Erdoberfläche, haust sie in ihrem Nest. Aber Rudolf Hermann war fast schon live dabei, im Kleinstaat, im Nest, als alles anfing. O 3 „... in die kühlen Kammern gelegt.“ In diesem Haufen hier finden bis zu eine Million Ameisen ihr Nest. Aber die Königin und ihr Volk haben ein Problem: Der Neststaat muss einem Gewerbegebiet weichen. Aber mit Rudolf Hermann naht Rettung! Und dann zieht der ganze Hofstaat um. In umgekehrter Reihenfolge werden die Etagen des Palasts wieder ausgeleert. Das Ameisennest stellt seine Ordnung selbst wieder her – gerettet von Rudolf Hermann. O 5 „... während Du vorm Fernseher sitzt, dann tue ich Ameisen umsiedeln im Frühjahr.” Nur: Im Fernsehen sehe ich mehr Royals als hier. Ein Haufen Reisig und Erde – da fehlt mir die Action. Es wimmelt mir zu wenig. Wir suchen weiter. Rudolf Hermann geht voraus. O 6 „... Jetzt werde ich mal eine wegnehmen.“ Er lässt sich auf die Knie fallen und fasst nach dem Haufen, greift nach einer Ameise. O 7 „... Das kann man nämlich erkennen, was das für eine ist.“ Das Insekt wackelt mit Beinen und Fühlern. Der Kennerblick verrät: O 8 „... den alten Baumstumpf, da, da ist noch ein Rest davon.“ Und auf dem Baumstumpf geht’s ab! Die Königin ist nicht in Sicht, aber es wuselt und zappelt in der Kolonie der Ameisen. Einer für alle, alle für einen, alle für alle! O 9 “...sie gehen sogar in den Tod für andere.” A propos Tod. Oder Leben – wie mans nimmt: Wie lange krabbelt’s sich denn so? O 10 „und ein, zwei Tage ne Drohne.“ Nur zwei Tage überleben meine Geschlechtsgenossen. Nicht viel, aber immerhin: Tage im Luxus – Tage der Liebe. O 11 „oder fangen ein neues Nest an, irgendwo als Einzelinsekt.“ Und dann schließt sich der Kreis, äh, das Nest und es entsteht ein neues – irgendwo. Wer suchet, der findet. Schädliche Tierliebe„Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“, heißt es im Tierschutzgesetz. Andernfalls ist das Tierquälerei. Sie kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden. Aber die Halter sagen, sie liebten ihre Tiere. Aber auch diese Zuneigung kann den Gepellzten, Gefellten und Gefiderten Gefährten zuviel werden.(18.02.2008) „Miau“ Immer wieder steht ein Schälchen Milch vor der Tür. Lieb gemeint, aber zwei Probleme ergeben sich damit: Milch schadet den Katzen, sagen die Tierschützer. Und sie warnen auch davor, fremde Katzen zu füttern – weil es vorkommen kann, dass die Katzen einen gesunden Eindruck machen, tatsächlich aber krank sind und spezielles Futter benötigen. Zum Beispiel gibt es Katzen mit Nierenleiden oder Diabetes. "Mähh" Ein ähnliches Problem kennen Halter von Ziegen: Brot und alte Backwaren, von Spaziergänger gefüttert, können für Ziegen und Schafe tödlich sein. Der Magen von Wiederkäuern ist auf solche Futtergaben nicht eingestellt und übersäuert. Das Tier verendet innerhalb kurzer Zeit unter Magenkrämpfen mit starken Schmerzen wegen einer so genannten "Pansenazidose". "Wau" [Schwerwiegende Folgen kann auch das Duschen von Hunden haben. Viele vertragen keine Seife oder Duschgel, weil sie die Fettschicht der Haut angreifen. Deshalb – und das wissen viele Hundehalter nicht – empfehlen Tierärzte, immer spezielles Hundeshampoo zu verwenden. Und duschen auch nur ein mal im Monat. Sonst verliert das Fell seinen natürlichen Schutz. Hunde mit ins Bett zu nehmen, kann auch zu einem Problem für den Hund werden. Denn von ihrer Natur her würden sie es nie wagen, das Lager des Rudelführers unaufgefordert zu belegen. Aber der Rudelführer ist für sie Herrchen oder Frauchen.] "Sipp" Blumen zum Valentinstag3,4 Milliarden Euro geben die Deutschen im Jahr für Schnittblumen aus. Rund ein drittel davon für Rosen. Die Magie der wohl schönsten aller Blumen ist also ungebrochen. Und gerade zum Valentinstag. Schließlich ist die Königin der Blumen gerade recht für die Herzdame. Aber – und da, Männer, aufgepasst !– die Rose ist auch empfindlich. Wo die besten herkommen – ob aus der Tankstelle oder aus dem Blumenladen um Die Ecke - und wie mit der Rose noch mehr Liebe geschenkt werden kann, weiß JASOfm.(13.02.2008) ATMO aus dem Blumenladen Es duftet nach Frühling im Blumenhaus Kärcher. Bis an die Decke sind Blumengestecke aufgetürmt - fertig gebunden und liebvoll gesteckt. Gegenüber stehen ein Dutzend Vasen mit verschiedenen Rosen – gelbe, rote, große, kleine. Aber auch faire und nicht faire. Ja, manche Rosen sind aus Massenproduktion, andere aus sozialverträglichem Handel wie die des Flower-Label-Programs. Händlerin Rosemarie Kärcher zieht von jeder Sorte eine Rose heraus und dreht sie zwischen den Fingern. O-TON Rosemarie Kärcher, Blumenverkäuferin Die Rosenzucht ist mitunter ein trauriges Geschäft: Viele Blumen wie Rosen wollen in Deutschland im Winter eben nicht gedeihen. Deshalb werden sie auf Blumenfarmen beispielsweise in Kenia oder Ecuador meist zu Hungerlöhnen gezogen und geerntet. Es gibt Kinderarbeit. Zudem werden Pestizide eingesetzt. Arbeiter erkranken. Dass es auch anders geht zeigen die drei Siegel namens FLP, FFP und Transfair. Die Blumen sind nur ein bisschen teurer. O-TON Rosemarie Kärcher, Blumenverkäuferin Für den geringen Preisaufschlag bekommt der Kunde aber auch Blumen besserer Qualität. Den Grund dafür kennt Meike Beutel. Sie ist Pflanzendoktorin der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. O-TON Meike Beutel, Pflanzendoktorin Das Ergebnis langer Lagerung hingegen sieht der Kunde oft bei Blumen aus Tankstellen und Supermärkten. Sie halten weniger lange, weil sie meist schon länger auf den Blumengroßmärkten lagerten. Die direkte Nähe zu Obst und Gemüse im Verkaufsraum schadet zusätzlich, da Reifegase sie schneller altern lassen. Auch Benzol und Abgase beim Tankstellenkauf lassen Blüten früh den Kopf hängen, hat die Stiftung Warentest festgestellt. Deren Untersuchung zeigt: Die besten Schnittblumen gibt’s doch im Blumenladen um die Ecke. O-TON Meike Beutel, Pflanzendoktorin Abmod: Schönes Winterwetter? Brauchen wir da Sonnenschutz?(12.02.2008) Keine Sorge, von den bisschen Wintersonnenstrahlen geht die Haut nicht gleich in Rauch auf. Aber: Unsere Winterhaut ist jetzt eben noch bleich, hat wenig Pigmente und ist die Sonne schlichtweg nicht mehr gewohnt. Die schützende Hornschicht ist auch weniger dick als im Sommer. Die Haut ist daher insgesamt schon sensibler. Ein Effekt, der durch die trockene Luft in geheizten Räumen noch verstärkt wird. Trotzdem brauchen wir keinen extra Sonnenschutz – in normalen Höhenlagen. Anders sieht es in den Bergen aus. Dort wirken die Sonnenstrahlen stärker, weil ihr Weg durch die Atmosphäre kürzer ist. Sie werden weniger gebrochen und gestreut. Wir werden dadurch zwar schneller braun. Aber auch schneller rot vom Sonnenbrand. Viel schwerwiegender ist aber der sogenannte Albedo-Effekt: Schnee und Eis reflektieren das UV-Licht und erhöhen damit die Gesamtbelastung auf die Haut ganz enorm – fast um das doppelte. Dann brauchen wir den wirklich guten Sonnenschutz. Aber wer im Flachland unterwegs ist, der hat ihn nicht nötig. Erdöl überallErdöl – das schwarze Gold. Viele denken da zuerst einmal an die hohen Spritpreise. Ohne Erdöl kein Benzin, ohne Benzin fährt das Auto nicht. Aber es fährt ohne Öl nicht nur weil der Kraftstoff fehlt. Gäbe es kein Erdöl, würde auch das Auto ziemlich unfertig aussehen.(12.02.2008) Ohne Erdöl wäre das Auto an sich ziemlich unbequem: Es gäbe keine bequemen und haltbaren Autositze. Denn Öl braucht es zur Herstellung des Schaumstoffs. Plastik braucht Öl: Viele Knöpfe und Schalter müssten durch Schnüre oder Holzregler ersetzt werden. Sie würden alle haken und quietschen, weil das Öl zur Schmierung fehlt. Und sicher wird das Autofahren auch nicht: Bei einem Unfall prallen die Insassen auf ein Armaturenbrett aus Holz oder Blech. Der Airbag fehlt ganz. Geräusch „Paff“ Dann sind auch noch die Straßen schlecht: In vielen Straßenbelägen findet sich das bei der Destillation von Rohöl anfallende Bitumen. Asphalt braucht Öl. Dann halt ins Büro laufen. Aber auch dort Plastik und Öl überall: Die Kabelummantelung, das PC-Gehäuse, die Kaffeemaschine. Geräusch „Kaffeemaschine“ Und statt Arbeiten einfach daheim ausspannen? Zeitunglesen? Schwierig ohne Druckerschwärze aus Öl. Ein kühles Bier? Die Kühlschrankflüssigkeit besteht aus einem Erdölprodukt. Sich erholen mit Schönmachen? Auch schwierig: Nylon, Perlon, Make-Up – Öl ist mit dabei. Musikhören? Statt CD aus Plastik gibt es nur Schellack. Geräusch „Schellackaufnahme“ Und Hunger haben wir auch: Weil Erdöl in Dünge- und Pflanzenschutzmitteln benötigt wird, gibt es ohne Ernteeinbußen. Weil unsere Kleider schmutzig sind – denn ohne Öl keine modernen Waschmittel – werden wir krank. Vor allem im Winter, weil Dichtungen von Fenstern und die Wärmeisolierung fehlen. Und Hustenbalsam kann man sich nicht leisten – weil ohne das als Paraffinum liquidum bezeichnete Erdöl - wäre er schlichtweg zu teuer. Fast alle modernen Medikamente kommen nicht ohne Öl aus. Geräusch „Niesen“ Leben ohne das schwarze Gold – unvorstellbar. Und trotzdem: Der kostbare Rohstoff, der Millionen Jahre brauchte, mit Hilfe von Druck und Wärme aus den Überresten toter Tiere zu entstehen, wird zu 90 Prozent verbrannt. Und 1000 Liter Erdöl ergeben gerademal 40 Kilo Plastik. WHO stellt Welt-Tabakbericht vorDie Weltgesundheitsorganisation WHO stellt zur Stunde (7.2.2008, 17 Uhr) ihren sogenannten Welttabakbericht vor. Rauchen gehört danach zu den weltweit führenden Todesursachen. Im Jahr sterben 5,4 Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.(07.02.2008) Alle sechs Sekunden stirbt auf der Welt ein Mensch wegen der Zigarette, rechnet die WHO vor und fordert Maßnahmen gegen das Rauchen - wie höhere Tabak-Steuer, ein striktes Verbot von Zigarettenwerbung, mehr Aufklärung und Hilfsprogramme für Raucher, die von der Sucht loskommen wollen. Die WHO schätzt, dass im vergangenen Jahrhundert 100 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben sind. Weil immer mehr Menschen rauchen, könnten es dieses Jahrhundert eine Milliarde Tote werden, zehnmal mehr, warnt die Organisation. Vor allem in Entwicklungsländern werde immer mehr geraucht. Die Werbung ziele dort besonders auf Jugendliche und junge Frauen. Rauchen zeigt nach den Zahlen der WHO auch den Entwicklungsstand eines Landes: Rund dreiviertel der Raucher weltweit leben in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. In den Industrieländern hingegen nimmt die Tendenz zum Rauchen ab. Die Daten des neuen Berichts erfassen 99 Prozent der Weltbevölkerung. - Schulterschluss für den Klimaschutz? Der CO2-Kompromiss beim Deutsch-Französischer Umweltrat / Wer stinkt, muss zahlen: London bittet Lastwagen zur Kasse / Für einen klaren Himmel - EU startet Initiative `Clean Sky` / Embryonale Stammzellenforschung an der Uni Konstanz / Traurige Kunst aus Müll – Deponien in Palästina(05.02.2008) Auf Initiative von Rheinland-Pfalz kam es im November 1989 zu einem diplomatischen Notenwechsel zwischen der deutschen und der französischen Regierung. Ziel war es, ein Gremium zu schaffen, das sich regionaler, nationaler und grenzüberschreitender Umweltthemen annimmt. Herausgekommen ist dabei der deutsch-französische Umweltrat. Er hat sich bisher mit grenzüberschreitender Abfallentsorgung, mit Naturschutz im Oberrheingraben und mit dem Biosphärenreservat Pfälzer-Wald-Nordvogesen befasst. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit: Absprachen zu deutsch-französischen Initiativen und das Abklopfen der Positionen in der europäischen Umweltpolitik. Und da haben der deutsche Umweltminister Gabriel und sein französischer Amtskollege Jean-Louis Borloo beim diesjährigen Umweltrat in Goslar einen großen Schritt aufeinander zu getan. Von einem „Engen Schulterschluss zwischen Deutschland und Frankreich in der Klima- und Naturschutzpolitik“ sprachen nach der Tagung gestern beide Politiker. Aber in einem wichtigen Streitthema – nämlich der CO2-Emmission von Autos – haben beide zwar Schritte aufeinander zu getan, stehen aber eben noch nicht Schulter an Schulter. Janek Wichers. [Einspielung] Die Emissionen in den Griff zu kriegen versucht auch der Londoner Bürgermeister Ken Livingstone. Vor fünf Jahren führte er die City-Maut für Autos ein. Alle großen Parteien – inklusive seiner Labour Party – äußerten sich damals skeptisch, Autofahrer fühlten sich diskriminiert, Geschäftsleute und Hoteliers fürchteten um ihre Umsätze und versuchten die Maut mit allen Mitteln zu verhindern. Doch bereits in den ersten Wochen schlug die öffentliche Meinung um. Livigstons Konzept überzeugte. Wegen dieser Leistung wurde er 2003 zum "Politiker des Jahres" gewählt und schließlich von den Londonern Bürgern bei den darauffolgenden Wahlen mit deutlicher Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Im Juni 2004 war das. Jetzt, vier Jahre später, steht Livingstone wieder im Wahlkampf und warum dann nicht noch mal das heiße, aber erfolgversprechende Eisen City-Maut anpacken? Rund 1000 Menschen sterben vorzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung, rechnet Bürgermeister Livingstone vor und macht London zu einer neuen LKW-City-Maut-Umweltzone. Wer stinkt muss zahlen. Ralf Borchard: [Einspielung] Schlechte Luftqualität. Dafür sorgen auch Flugzeuge. Marktprognosen gehen davon aus, dass der Flugverkehr in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr um etwa fünf Prozent wächst. Umweltschutz spielt daher in diesem Bereich auch eine immer größere Rolle. Die Europäische Kommission hat jetzt das umfangreiche Technologieprogramm "Clean Sky" gestartet. Ulrike Bosse: [Einspielung] Derzeit dürfen Forscher in Deutschland nur Stammzellen verwenden, die vor 2002 im Ausland entstanden. Damit soll verhindert werden, dass ein Anreiz zur Vernichtung weiterer menschlicher Embryonen geschaffen wird. Der Bundestag wird voraussichtlich Mitte Februar über eine Liberalisierung des Gesetzes debattieren. Als konkretes Beispiel herhalten muss dann vielleicht auch die Universität Konstanz. Dort kann ab sofort mit menschlichen embryonalen Stammzellen geforscht werden. Die Genehmigung dazu erteilte das Robert-Koch-Institut. Es berichtet Vera Pache. [Einspielung] Im Herbst vergangenen Jahres hat eine Gruppe deutscher und palästinensischer Künstler an einer außergewöhnlichen Installation gearbeitet: Sie besteht im Wesentlichen aus Müll, gesammelt auf Deponien in den Palästinenser-Gebieten. Die Ausstellung mit dem Titel "Transform Orchestra" wurde bereits in Ramallah, Gaza und Jerusalem gezeigt. Jetzt ist sie auf dem Berliner Kunstfestival "transmediale" zu sehen und sie zeigt, dass auch von Müll noch künstlerische Energie ausgehen kann. Müll als Exportprodukt. Nur die Bilder, die Mirko Heinemann aus den palästinensischen Autonomiegebieten mitgebracht hat, machen mehr als traurig. [Einspielung] ENDE Mit dem Umweltminister auf China-Tour / Der Bali-Gegengipfel auf Hawaii / Erste Hybrid-LKWs aus Deutschland / Italien kämpft gegen rabiaten Rüsselkäfer / 130-Millionen-Spende für Bangladesch / Riesenwindräder spalten die Dorfgemeinschaft(31.01.2008) Der Frost zwischen Berlin und Peking taut im milden Januar dahin. Der Empfang der Bundeskanzlerin für den Dalai Lama im vergangenen Jahr hatte für heftige Verstimmungen gesorgt. Diplomatische Eiszeit sozusagen. Dann folgte jetzt die Klimaerwärmung und Bundesumweltminister Sigmar Gabriel ist das erste Regierungsmitglied, das wieder ins Land des Lächelns reist. Mit im Gepäck hat er viel Gesprächsbedarf zu Umweltfragen und Lösungen aus der deutschen Umwelttechnik. Erste Station: Der Süden des Landes. + Einspielung Dem China-Besuch gab Sigmar Gabriel auch den Vorzug vor der gleichzeitig stattfindenden Klima-Konferenz auf Hawaii. In Honolulu tagen derzeit auf Einladung des amerikanischen Präsidenten die 16 größten Wirtschaftsmächte. Es ist die zweite Auflage des sogenannten Major-Economies-Meetings. Für die deutsche Regierung nimmt Umweltstaatssekretär Matthias Machnig an dem Treffen teil. Beim ersten Termin in Washington im September war Sigmar Gabriel noch selbst angereist. Damals hatten viele Teilnehmer noch den Verdacht, die USA machten das Meeting zu einer Amerika-Dominierten Parallelveranstaltung zu den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen. Und jetzt Honolulu - der Gegengipfel zu Balì? + Einspielung Mit der lahmen Ente verglichen Umweltverbände lange Zeit auch die deutsche Autoindustrie: Umweltfreundlichere Autos liefen lange Zeit nicht von den deutschen Fließbändern sondern von denen der Japaner. Jetzt - mit himmelblauen Ökolinien und grünen Autos made in Germany schien der Rückstand aufgeholt. Aber auf dem Gebiet der Lastwagen offenbart sich schon die neue Lücke: Während in Japan Hybrid-LKWs schon zum Verkehrsbild gehören, übergab erst diese Woche ein Deutscher Hersteller zwei Hybrid-Lastwagen dem Alttagsgebrauch – und das nur im Testbetrieb. Ein Entwicklungsrückstand, wissen auch Passanten in der Stuttgarter Innenstadt: + Einspielung Der Klimawandel sorgt für das große Krabbeln. Immer mehr Insekten stoßen in Regionen vor, in denen sie bisher auf Grund von Kälte gar keine Überlebenschance hatten. Beflügelt von milden Wintern und heißen Sommern fallen bald Horden von Schädlingen über uns her, befürchten Experten. In Italien hat sich jetzt ein Käfer eingenistet, dessen Reiseweg sich von den tropischen Gebieten Asiens über Afrika bis ans Mittelmeer nachverfolgen lässt. + Einspielung Längst sind der Zyklon "Sidddr" und seine Folgen aus den Medien verschwunden. Zweieinhalb Monate ist es her, dass der Wirbelsturm mehr als 3000 Menschen in den Tod riss. Millionen blieben ohne Obdach, ohne Nahrung. Hilfe gab es wenig: Jede Familie erhielt umgerechnet 5 Euro und 10 Kilo Reis. Einem wohlhabenden Menschen war das zu wenig. Jetzt spendete er Bangladesch 130 Millionen Dollar. + Einspielung In Trierweiler – einer kleinen Gemeinde in der Eifel – spaltet sich die Dorfgemeinschaft in der Debatte um Windräder. Nicht um Windräder überhaupt - davon gibt es schon vier in der Gemeinde. Nein, es geht neue Windräder. Sie sollen zwei der schon bestehenden Anlagen ersetzen. Aber weil die geplanten neuen, so riesig sind, zwischen 150 und 180 Meter hoch, wurde eine Bürgeranhörung eingeleitet. Unsere Reporterin hörte mit und sah sich am Ende des Bürgerabends zwischen Befürwortern und Gegnern der Windräder: + Einspielung Impfstoff gegen Koks(30.01.2008) Amerikanische Wissenschaftler haben eine Impfung gegen Drogensucht entwickelt. Zunächst soll das Verfahren bei Kokain helfen. Damit könnte 330.000 Kokainkonsumenten in Deutschland eine Hilfe zum Ausstieg aus ihrer Sucht gegeben werden. Das Prinzip der Drogenimpfung ist denkbar simpel: Der menschliche Körper behandelt die Droge einfach wie ein Virus. Das Immunsystem tötet die Droge dann ab als wäre es eine Erkältung. Der Suchtstoff hat dann gar nicht die Zeit, das Gehirn zu erreichen. Das erhoffte Hochgefühl bleibt aus. Der Patient werde während der Therapie allmählich immun gegen die Droge, sagt Thomas Kosten vom Baylor College für Medizin im amerikanischen Houston. Sein wissenschaftlicher Coup: Drogenmoleküle wie Kokain wären normalerweise zu klein als dass sie das Immunsystem erkennen könnte. Bei der neuartigen Impfung werden die Stoffe aber mit Proteinen gekoppelt. Werden sie mit der Spritze verabreicht, bildet der Organismus die Anti-Körper. Absage Warten auf Blauzungenimpfstoff(30.01.2008) Die gute Nachricht für Rinderhalter und Schäfer: Der Impfstoff gegen die Blauzungenkrankheit ist fertig. Nur die Auslieferung wird andauern. Und: Wegen des milden Winters nimmt das Infektionsrisiko dieses Jahr wieder zu. Allein in Rheinland-Pfalz (Baden-Württemberg) war die Infektion vergangenes Jahr bei rund 3000 (500) Tieren festgestellt worden. Die Zeit für die Halter von Rindern und Schafen wird knapp: Der Impfstoff gegen die Blauzungenkrankheit ist zwar fertig entwickelt. Aber erst in anderthalb Monaten werden die Länder die Impfstoffe bestellen können. Denn bis dahin läuft das Ausschreibungsverfahren für das neue Präparat. 150 Millionen mal wird es Schätzungen zufolge in Europa benötigt. Die EU will einen Großteil der Impfkosten übernehmen. Deutschland hat seinen Impfplan in Brüssel bereits eingereicht. Wegen der großen Nachfrage könnten die deutschen Veterinärämter aber frühestens im Mai die ersten Impfstoffe erhalten, sagen die Hersteller. Und dann nur in zu kleinen Mengen. Zuerst würden die besonders betroffenen Gebiete beliefert. Um wirklich dem vollen Bedarf gerecht zu werden, brauchten die Impfstoffhersteller aber mindestens noch ein halbes Jahr Zeit. Frankreich und Großbritannien sind da schon weiter: Sie stehen laut Impfstoffherstellern bereits mit ihnen in Verhandlungen. Experten fürchten jetzt, dass die Blauzungenkrankheit wieder zunimmt. Denn der Winter war zu warm, als dass er die Mücken ausreichend abgetötet hätte. Sie übertragen die Blauzungenkrankheit. Sobald die Temperatur wieder steigt, fliegen auch die sogenannten Gnitzen wieder und können das Blauzungenvirus namens BTV8 übertragen. Infizierte Tiere leiden an hohem Fieber und Entzündungen im Maul, die Zunge läuft blau an. Schafe und Ziegen können an der Krankheit sterben. Rinder geben zumindest weniger Milch. Im vergangenen Jahr traten allein in Deutschland 20 000 Fälle der Blauzungenkrankheit auf. Für Menschen ist die Infektion ungefährlich. Für die Halter von Rindern und Schäfer entstehen Schäden in Millionenhöhe. Blütenpollen jetzt schon im Januar(22.01.2008) „Alle Jahre wieder“ denken sich viele Allergiker, wenn sie das erste mal im neuen Jahr niesen müssen und tränende Augen bekommen. Für viele Betroffene ist es das, was ihnen die Schönheit am Frühling vermiest: Die Blumen blühen zwar schön, aber was aus den Blüten rauskommt sorgt für Unwohlsein. Und damit nicht genug: Der Pollenbeschuss fängt jetzt auch schon im Januar an. Es geht wieder los! Die Blütenpollen fliegen und bescheren den Allergikern tränende Augen, triefende Nasen und... Geräusch Nieser ... Niesanfälle. Und das schon im Januar! Der Deutsche Wetterdienst hat bereits Pollen von Haselnuss und Erle gesichtet. Auf sie reagiert ein großer Teil der Allergiker und das gut einen Monat früher als im Durchschnitt vergangener Jahre. Mit dem früheren Auftreten der Pollen wird sich die Pollenfolter leider nicht nur verschieben - sondern verlängern. Gleichzeitig kommen neue Pollenarten und somit neue Allergien dazu, die sogar noch spät im Herbst wirken – etwa die der Ambrosia. Die Folge: Es gibt immer mehr Pollenallergiker die immer schwerer leiden, weiß der Allergologe Professor Joachim Saloga: O-TON Professor Joachim Saloga: „Durch längeren Pollenflug werden Symptome schwerwiegender.” Allergien sind fehlgesteuerte, übertriebene Reaktionen des Immunsystems auf bestimmte Stoffe in der Natur. Bei einem Pollen-Kontakt werden in der betroffenen Körperzelle biologisch hochaktive Stoffe freigesetzt. Histamin zum Beispiel. Diese Stoffe führen zu einer Art Entzündung. Eine Hyposensibilisierung soll dagegen helfen. Nur kann sie am besten im pollenlosen Winter angewandt werden. Aber was wenn jetzt schon die Pollen fliegen? [ Nach Hasel und Erle werden sich als nächstes die Pollen der Birke auf den Weg in die Schleimhäute machen. Normalerweise startet diese Nies-Saison Anfang April. Jetzt kann es Ende Februar werden. Der milde Winter beflügelt auch die Birkenpollen - früher als sonst. Beauty für den Mann(18.01.2008) "So schön kann doch kein Mann sein..." sang einst Gitte Haenning. Und es geht doch: Die Kosmetik- Industrie will, dass Deutsche Männer sich genauso gerne schön machen wie ihre italienischen und französischen Geschlechtsgenossen – mit Kajal, Lippenstift und Make-Up. Welchen Effekt das hat zeigt ein Selbstversuch auf der CMT-Tourismusmesse in Stuttgart. Bodensee-Tag auf der CMT(11.01.2008) Das Modell des alten Raddampfers Hohentwiel, der schneebedeckte Säntis auf einem großen Plakat. Aber dann ist es am Bodenseestand mit der Romantik auch schon vorbei. Denn die Apfelkönigin Ann-Kathrin Wirth hat schwer zu kämpfen: Messebesucher reißen ihr ihre Äpfel nahezu aus der Hand. Aber die Apfelkönigin bleibt royal gelassen. O-TON Ann-Kathrin Wirth Der Bodensee-Tag auf der CMT: Auf 100 Quadratmetern präsentiert sich die Region. Der Stand ist seit Samstag immer gut besucht - vor allem von Touristen, die schon ein oder mehrmals Urlaub am Bodensee gemacht haben. Sogenannte Wiederholer. Bei ihnen heiß begehrt: der Erlebnisplaner 2008 mit den kulturellen Höhepunkten in der Region. Einer davon etwa am 20. April: Dann wird der 200 .Geburtstag von Kaiser Napoleon dem Dritten im Schloss Arenenberg und Konstanz gefeiert – mit großen Ausstellungen. Aus diesem Anlass lässt es sich seine kaiserliche Majestät nicht nehmen, persönlich am Bodenseestand dafür Werbung zu machen. Allerdings verschnupft. O-TON Dominik Gügel Große Augen bekommen die Besucher vor dem Stand, wenn Museumsdirektor Dominik Gügel ihnen erzählt, dass Napoleon der Dritte als Neffe vom großen Feldherren Napoleon dem Ersten der Kaiser des Bodensees genannt wird. O-TON Dominik Gügel Nicht nur die klassischen Kultururlauber werden an den Bodensee gelockt. Auch bei jungen Aktivtouristen konnte die IBT diese Woche punkten. Auf der Sonderausstellung am vergangenen Wochenende informierten sich zahlreiche Messebesucher über modernes Fahrradwandern mit Hilfe von satellitengestütztem GPS. Den Navigator bemühen musste nach einer Autobahnsperrung heute auch der Geschäftsführer der Zeppelinreederei Thomas Brandt. Die Messe ein Muss für ihn: Werbung machen für Zeppelinflüge zum erstenmal in den neuen Hallen. Und wie gefallen sie ihm? Thomas Brandt, Geschäftsführer Zeppelinreederei, „Messe eigentlich blöd“ Mitte März gehen die Zeppeline wieder in die Luft – auch ein wichtiger Termin im Kalender vieler Bodenseetouristen. Nicht nur der Bodensee, die ganze Welt lockt die Besucher auf die CMT. Sie alle haben ihre Taschen voller Reiseprospekte. Auch Thomas Brandt hat bei seinem Messebesuch etwas besonderes gefunden: Kleine Wissenschaftler jagten die BergmannskuhWer weiß heute noch, dass eine Bergmannskuh gar keine Kuh, sondern eine Ziege ist? Kinder der Grundschule Mittelbach in Zweibrücken! Denn sie sind in einer Begabtenklasse schon für Kinder im Vorschulalter. Entdeckertag heißt das Projekt. Und diese Entdeckertag-Klasse hat die Geschichte der Bergmannsbauern erforscht und dafür sogar einen Preis eingefahren. JASOfm hat die erfolgreichen Entdeckertagskinder gleich mal über Bergmannskühe ausgequetscht.(19.07.2007) O-TON So fängt sie an - die kleine Zeitreise mit kleinem Personal. Sophie, Kevin, Simon, Klemens, Moritz, Ina und Sarah sind zwischen sieben und acht Jahren. Aber sie erzählen in ihrer Computerpräsentation Geschichten aus einer Zeit lange vor ihrer Geburt. Aber sie erzählen so, als hätten sie die Zeit selbst miterlebt. O-TON Thema dieses besonderen Heimatunterrichts: Die Bergmannsbauern. Sie waren vorher ganz normale Bauern, die sich zur Zeit der Industrialisierung vor rund 200 Jahren dem Kohleabbau zuwendeten. Sie erhofften sich von der Arbeit in den Gruben der Region mehr wirtschaftliche Sicherheit. O-TON OTON Der besondere Unterricht schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Kinder lernen etwas über ein Thema. Aber sie lernen auch das Lernen an sich, sagt Schul- und Projektleiterin Karolina Engel. O-TON Engel Neben dem doppelten Lerneffekt gibt es noch 250 Euro. Denn mit ihrer Präsentation machte die Klasse auf Landesebene den ersten Platz. Ausgeschrieben hatte den Geschichtswettbewerb niemand geringerer als der Bundespräsident. Aber was wird jetzt aus dem Preisgeld? O-TON Engel So soll es sein: Die 250 Euro Preisgeld werden gleich wieder in die Bildung re-investiert. Bleibt nur noch die Frage offen, warum die Bergmannskuh eine Ziege ist und keine Kuh: O-TON Zecken-Impfstoff ist alleKaiserslautern: Der Impfstoff gegen durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung ist nahezu ausverkauft. Wie Gesundheitsämter der Region mitteilen, gibt es kaum noch Ärzte oder Apotheken, die den Impfstoff vorrätig haben.(16.07.2007) Nach Angaben des Gesundheitsamts in Kaiserslautern ist der Impfstoff gegen Frühsommer- (13.07.2007) Sieben Mal in diesem Jahr hat die Polizei bereits LKW-Großkontrollen nachts auf der B10 durchgeführt. Das Ergebnis: Jeder dritte kontrollierte Lastwagen durfte gar nicht fahren. Es fehlte die Ausnahmegenehmigung. Seit anderthalb Jahren gilt auf der Verbindung von Landau nach Pirmasens Nachtfahrverbot für den schweren Durchgangsverkehr. Wer sich nicht daran hält, muss mit 20 Euro Bußgeld rechnen. Das hindert die Lastwagenfahrer nicht daran, durch die Pfalz abzukürzen oder Autobahnmaut zu sparen. Allein vergangene Nacht wurden bei Hinterweidenthal drei ausländische LKWs verwarnt und das Weiterfahren untersagt. Damit in Zukunft noch weniger Laster unerlaubt die B10 nutzen, will die Polizei ihre Kontrollen beibehalten und nach Möglichkeit ausbauen.
(12.07.2007) O-TON Jürgen Billen „Wir machen eine Drogen und Alkoholkontrolle. Ich hätte gerne Ihren Führerschein gesehen, den Fahrzeugschein.“ Tief in der Nacht an der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Landstuhl. Oberkommissar Jürgen Billen kontrolliert ein Auto. Sein Kollege, Hauptkommissar Reiner Hüttel, winkt mit seiner Kelle schon das nächste heran. Es werden ganz bestimmte Fahrer herausgewunken – die mit jungen Leuten hinterm Lenkrad. O-TON Reiner Hüttell „Haben Sie alkoholische Getränke zu sich genommen? Steigen Sie bitte mal aus.“ Gerade ist eine junge Frau an der Reihe, 19, vielleicht 20 Jahre alt. Alkohol riecht man nicht aus ihrem Auto. Aber: Sie ist nervös. Ihre Papiere werden geprüft, dann kommt die Frage: O-TON Jürgen Billen „Haben Sie schon mal Drogen genommen?“ Es folgt ein kurzer Test. Er kann den Anfangsverdacht des Polizeibeamten ausräumen - oder bestätigen. O-TON Jürgen Billen „Ich leuchte Ihnen jetzt in die Augen...“ Der runde Lichtkegel schiebt sich langsam über die rechte Gesichtshälfte. Als er auf das Augen trifft, macht die Iris sofort zu. O-TON Jürgen Billen „Ah, alles ok, tschüss“ O-TON Reiner Hüttell „Hasch ist das kleine Bier wie früher“ Rund 30 Fahrzeuge werden bei dieser Kontrolle herausgewunken. Die Jugendlichen nehmen es gelassen, wenn sie ins Röhrchen blasen müssen oder die Taschenlampe über das Gesicht wandert. O-TON UMFRAGE Nicht jeder verbindet mit Drogen im Straßenverkehr persönliche Erlebnisse. Deshalb gehört es auch zu Reiner Hüttels Aufgaben, in den Schulen Präventionsarbeit zu leisten. Bis zu dreimal stehen Drogen und ihre Wirkung beispielsweise auf dem Stundenplan eines Gymnasiasten. O-TON Reiner Hüttel „Die Problematik ist ein Thema. Teilweise wird Gefahr zu gering eingeschätzt.“ Unter Drogen fahren – nicht nur eine Gefahr für die anderen. Auch die Jugendlichen selbst müssen nicht nur Strafe zahlen, sondern sie riskieren auch ihren Führerschein – für einen Monat oder bei schweren Fällen für immer. Und dann das Drogenscreening, also ständige Kontrollbesuche beim Arzt - und schließlich: der Idiotentest. Diesmal, zwischen Kaiserslautern und Landstuhl blieb das allen kontrollierten Fahrern erspart. ATMO POLIZEIKONTROLLE
(10.07.2007) Die 71.000 Euro hatte H. hinterzogen, als er in seiner Gärtnerei französische Grenzgänger als Saisonarbeiter anstellte. Sein Anwalt erklärte auf Anfrage des SWR, H. akzeptiere den Strafbefehl, damit es nicht zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung komme. H. befürchte, mit einer Verhandlung ins Rampenlicht gerückt zu werden. Er müsse sich auf seine Arbeit als Unternehmer konzentrieren. Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftssachen in Kaiserslautern hatte seit Anfang 2006 gegen H. ermittelt. Er war damals Landtagsabgeordneter. Wegen der Ermittlungen hatte der Landtag damals H. Immunität aufheben müssen.
(10.07.2007) Nach dem Tod ihres Opfers machten die Täter mit ihren Handys Fotos von der Leiche. Zuvor hatten sie den 36 Jahre alten und alkoholisierten Mann mit Tritten und Schlägen misshandelt. Dann versetzten sie ihm zahlreiche Stiche in den Hals- und Brustbereich. An den Verletzungen starb der Mann. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Täter den Mann berauben wollten. Sie fanden lediglich 65 Euro. Die Staatsanwaltschaft sieht den Tatbestand des Mordes gegeben, weil die Angeklagten nach bisherigem Ermittlungsstand ihre Tat geplant und offenkundig aus Mordlust gehandelt haben. Die Angeklagten haben ihre Tat gestanden. Sie sollen nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Ihnen droht eine Strafe von bis zu zehn Jahren.
(09.07.2007) (Atmo aus dem Weinkeller, Winzer besprechen Weine) Die Wahl fällt schwer: Hier im Refektorium der Einselthumer Martinspforte stehen 40 Wein-Sorten auf dem Tisch. Aber nur 12, vielleicht auch ein paar mehr schaffen es auf die Einselthumer Tafelrunde. Denn für die rund 250 Gäste soll es nur das beste vom besten geben – aber Winzer Herbert Beyer ist mit der Vorauswahl mit Weinen seiner vier Kollegen aus dem Ort schon ganz zufrieden: O-TON Herbert Beyer: „Mit den Weinen lässt sich schon ganz gut strunze, wie wir Pfälzer sagen.“ Richtig strunzen – also sich’s so richtig gut gehen lassen - werden die Gäste auch beim Fünf-Gänge-Menü: Küchen-Chef ist der Star-Koch Martin Scharff von der Wartenberger Mühle und seine kulinarische Zeitreise geht vom Pfälzer Saumagen über die Gebratene Wachtel hin zum Höhepunkt, der Krustensau vom Spieß mit Kartoffel-Gurken-Salat und rotem Rettich. So deftig es auch auf dem Teller zugeht: Am Tisch selbst sollen die Manieren aber ganz modern sein. O-TON Herbert Beyer: „Wir haben zuerst überlegt, ob wir es so machen mit Knochen an die Wand werfen und so. Aber so ist es schöner.“ Mittelalter erleben werden die Gäste der Tafelrunde vor allem im Begleitprogramm: Der Bürgermeister aus der Nachbargemeinde Eisenberg, Adolf Kauth, wird zum Ritter geschlagen, die Mittelalter-Musiker „Die Geyers“ spielen auf und das Personal ist als Mägde und Knechte verkleidet. Und die Tafelrunden-Teilnehmer selbst? Müssen sie auch im Leinen-Hanf-Untergewand mit Tütenärmeln und Gebende auf dem Haupt kommen? Winzer Jörg Beyer gibt Entwarnung: O-TON Jörg Beyer: «Es kommen welche in Ritterrüstung ... aber man kann ganz leger auftauchen ohne Bastschuhe oder so.“ Nach drei Jahren lebt das Mittelalter-Gelage auf der Einselthumer Hauptstraße wieder auf und bildet den Auftakt der Einselthumer Weinkerwe. Am Donnerstagabend geht es los. Und bis dahin steht auch fest, welcher Wein zum rostigen Ritter auf Beerengrütze dargereicht wird. (Atmo unter Abmod ab „...Auslese dazu nehmen könnten. Hascht Du noch mal eine Auslese da?“) Die Weinprobe im Refektorium dauerte auf jeden Fall noch bis tief in die Nacht. Für das exquisite Mittelaltermahl in Einselthum an der 150 Meter langen Tafel gibt’s noch Karten für 79 Euro je Person. Fünf-Gänge und soviel Wein wie man trinken kann – Kartenbestellungen unter www.WeingutMüller-Metzger.de
(09.06.2007) Diese Arbeitskräfte sind im allgemeinen willig und fleißig, natürlich haben sie nicht diesen Mumm in sich wie die deutschen Arbeiter." Gastarbeiter aus Italien in Rheinland-Pfalz: Die Deutschen Unternehmer reagieren darauf mit zwiespältigen Gefühlen: Die Fabriken können jetzt mehr produzieren, der Aufschwung scheint gesichert. Aber eine ganz neue, unbekannte Mentalität hält Einzug an den Fließbändern. "Man muss die Italiener unbedingt singe lasse. Man glaubt es net, aber die könne arbeite und singe gleichzeitig ... Aber der Italiener der bringt das auch fertig". Bis im Werk italienisch gesungen wurde, gab es ein langes politisches Hin und Her. Anfang der 50-er Jahre will die Bundesregierung lieber die sechs Prozent Arbeitslose in Arbeit bringen. Aber für deutsche Arbeitslose ist Flexibilität damals ein Fremdwort. Sie leben in strukturschwachen Gebieten und wollen für Arbeit nicht umziehen. Also kommen zuerst die Italiener. Einer von ihnen: Franco Del Vecchio: "Das war die Zukunft: Man brauchte nur nach Deutschland zu kommen, eine Schaufel und einen Sack. Und dann war der Sack voll mit Geld". Bis der Sack voll war, mussten die italienischen Gastarbeiter aber erst mal selbst viel aufbringen: tagsüber harte Arbeit etwa im Bergbau, nachts schlafen in Baracken. Und dann noch das deutsche Essen: "Das Essen war von vornerein eine Katastroph" Not macht erfinderisch, denkt sich auch Gastarbeiter Bruno Bellini. Warum den Deutschen nicht die italienische Küche schmackhaft machen? Erste Hürde, die deutsche Bürokratie, erinnert sich Bellini. Der Zuständige hat zu mir gesagt, was bilden Sie sich überhaupt ein? Wer glauben Sie, dass Sie sind, dass Sie hier herkommen und ein Lokal aufzumachen und hat mir die Schankerlaubnis verweigert. Ein Anwalt musste helfen. Und so erschloss Bellini auch für die Menschen in Rheinland-Pfalz langsam aber sicher kulinarisches Neuland: "Die Leute haben Pizza für Pfannkuchen gehalten" Die Gastarbeiter haben Multikulti nach Deutschland gebracht. Und Deutsches in ihre Heimat mit zurückgenommen: Das Dorf Atena Locana in Süditalien etwa ist reich und sauber - typisch deutsch eben. Der Grund: Die vielen Gastarbeiter, die hier her zurückgekehrt sind - wie Antonio Marino. 19 Jahre lang hat er in der deutschen Gastronomie geschuftet, 7 Tage bis zu 16 Stunden täglich. Jetzt ist er Chef seines eigenen, erfolgreichen Hotels - in seiner Heimat Italien. (it darüber dt Übersetzung) "Ich habe Deutschland viel zu verdanken. Es ist eine Nation, die mir und meiner Familie Leben und Licht gegeben hat." Und auch Deutschland hat von den Gastarbeitern profitiert: Das Wirtschaftswunder hätte es ohne sie nie gegeben. Erst die Ölkrise bremste die Jahre des stetigen Wachstums aus. Und 1973 verabschiedete die Bundesregierung den Anwerbestopp."
(06.06.2007) EU will Eu-weites Bleiberecht Kein Disziplinarverfahren für Koran-Richterin Strommärkte rücken zusammen Sittensen-Mörder unter Anklage Stradivari wieder da (05.06.2007) Beck reist nach Ruanda Drucker-Warnstreik Leiche war Drogenkurier Staubexplosion verursachte Brand Schulklasse gewinnt 5.000 Euro Mehr Behinderte in Landesdienst Haftstrafen für Schlecker-Räuber Eisblockwette gestartet Niessen wird NADA-Chef Komische Verfolgungsjagd (04.06.2007) Bau-Schlichtung abgelehnt (01.06.2007) Kämpfe um libanesisches Lager eskalieren (30.05.2007) München - Der ehemalige Chef der Siemens-Betriebsrats-Organisation AUB, Schelsky, hat zugegeben, für die Siemens-Konzernspitze gearbeitet zu haben. Schelsky sagte dem Magazin Stern, er habe als Lobbyist im Auftrag der Konzernspitze gehandelt. Es seien aber keine konkreten Entscheidungen von Betriebsräten erkauft worden. Schelsky war vor drei Monaten verhaftet worden. Ihm wird Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Über Berater-Firmen soll er allein in den vergangenen sechs Jahren rund 45 Millionen Euro von Siemens erhalten haben. Die Überweisungen an Schelsky reichen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bis Anfang der 90er Jahre zurück. Brüssel - Die EU-Kommission verzichtet vorerst auf strengere Regeln zum Schutz vor Übergewicht. EU-Gesundheitskommissar Kyprianou hoffe darauf, dass die Lebensmittelindustrie und die Mitgliedsstaaten von sich aus gegen Fettleibigkeit kämpfen und Lebensmittel klar und verständlich kennzeichnen. Sollte es durch die Selbstregulierung bis 2010 jedoch keine Fortschritte geben, dann werde die Kommission auch über neue Gesetze nachdenken. Mehr als die Hälfte aller Europäer ist übergewichtig. (25.05.2007) Husum - In der nordfriesischen Stadt beraten die Finanzminister von Bund und Ländern, wie die Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe verwendet werden sollen. Bund, Länder und Kommunen erhalten in den kommenden fünf Jahren etwa 180 Milliarden Euro mehr als erwartet. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Carstensen forderte die Minister auf, am strikten Sparkurs festzuhalten. Die Finanzminister beraten auch, wie Reformen bei der Kleinkinderbetreuung oder bei der Erbschaftssteuer finanziert werden sollen. (24.05.2007) Kundus - In der nordafghanischen Stadt haben 700 Menschen dafür demonstriert, dass die deutschen Soldaten in der Region bleiben. Der Sicherheitschef der Provinz sagte, an der Demonstration hätten unter anderem Religionsgelehrte, Schüler und Studenten teilgenommen. Mit der Kundgebung reagierten die Demonstranten auf den Terrorangriff, bei dem vorige Woche drei deutsche Soldaten getötet wurden. (23.05.2007) Ankara - Die verbotene Arbeiterpartei PKK weist die Verantwortung für den Anschlag gestern in Ankara zurück. Das teilte die PKK in einem Schreiben an eine türkische Nachrichtenagentur mit. Der Gouverneur von Ankara hatte gesagt, die türkische Polizei ermittele gegen die PKK. Die Art des Anschlags und der verwendete Sprengstoff erinnere an bisherige PKK-Anschläge. Die Polizei geht von einem Selbstmordanschlag aus. Der mutmaßliche Attentäter war der Polizei bekannt. Der 28 Jahre alte Mann aus Anatolien habe zwei Jahre im Gefängnis gesessen. Der Anschlag ereignete sich gestern an einer Bushaltestelle im Zentrum Ankaras. Sechs Menschen kamen ums Leben. Mainz - Bundesweit haben sich heute nach Gewerkschaftsangaben rund 25 000 Menschen an Streiks und Protesten gegen die Telekom beteiligt. Allein in Mainz protestierten 1 800 Mitarbeiter mit Trommeln, Tröten und Sirenen gegen geplante Stellenauslagerungen. Bei dem Demonstrationszug warnten Spruchbänder vor Lohndrückerei und Arbeitsplatzvernichtung. Verdi droht damit, dass sich der Arbeitskampf über das ganze Jahr hinziehen könnte. Gewerkschaftssprecher Hau warf der Telekom vor, dass es seit fast drei Wochen keine Verhandlungen mehr gegeben habe. Mitarbeitern würden stattdessen Streikbrecher-Prämien angeboten. Belgrad - 13 Angeklagte im Mord-Prozess um den früheren serbischen Regierungschefs Djindjic sind schuldig gesprochen worden. Dies teilte das Sondergericht in Belgrad mit. Den Angeklagten drohen jeweils bis zu 40 Jahre Haft. Als Organisator des Verbrechens wurde der frühere Chef der paramilitärischen Einheit «Rote Barette», Milorad Ulemek, verurteilt. Er gilt als der Drahtzieher des Attentats. Das Strafmaß sollte im Lauf des Tages verkündet werden. Der Reform-Politiker Zoran Djindjic war vor vier Jahren erschossen worden.
(22.05.2007) Karlsruhe, 22.5.2007 - Die Polizei hat von Gegnern des G8-Gipfels in Heiligendamm Körpergeruchs-Proben genommen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Die Polizeihunde sollen mit Hilfe der Proben gewaltbereite G-8-Gegner später wiedererkennen. Nach einem Bericht der „Hamburger Morgenpost“ mussten in Hamburg bereits zwei Menschen Proben abgeben. Das Vorgehen der Behörde sei „ein schwerer Eingriff in die Grundrechte“, zitiert die Zeitung den Anwalt eines Verdächtigen. Die Abnahme von Geruchsproben sei bisher als Überwachungsmethode der ehemaligen DDR-Staatssicherheitsbehörde Stasi bekannt. Die Probe wird mit einem langen Metallrohr abgenommen, das die Betroffenen drücken müssen. Überlingen-Gutachter: „Skyguide ist schuld“ Zürich, 21.5.2007 - Im Strafprozess um das Flugzeugunglück von Überlingen hat ein Gutachter Vorwürfe gegen die Schweizer Flugsicherung Skyguide erhoben. Schuld am Unglück sei Skyguide, sagte der Gutachter vor dem Bezirksgericht im schweizerischen Bülach bei Zürich. Zur Katastrophe geführt hätten unzureichende Kenntnisse, mangelnde Kommunikation und unklare Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens. Die Flugleitstelle sei mit nur einem Lotsen besetzt gewesen. Das entspreche nicht den internationalen Standards. Der Lotse sei überfordert gewesen. Ihn treffe keine Schuld am Unglück, sagte der Gutachter. Berlin, 21.5.2007 - Die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand erwartet, dass dieses Jahr im deutschen Mittelstand mehr Menschen eingestellt als entlassen werden. Zuletzt war das vor sieben Jahren so. Nach Schätzungen der Arbeitsgemeinschaft dürften in Handel, Handwerk und Gastronomie 70.000 neue Stellen entstehen. Die Arbeitsgemeinschaft spricht von einer Beschäftigungswende. Grund dafür sei neben dem Wirtschaftswachstum auch die Politik der Großen Koalition. Die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand ist ein Zusammenschluss verschiedener Branchenverbände. Umweltverschmutzung: Mehr Chinesen sterben an Krebs Peking, 21.5.2007 - Wegen der Umweltverschmutzung in China sterben dort offenbar immer mehr Menschen an Krebs. Eine Pekinger Zeitung zitiert aus einer Studie von rund 100 chinesischen Städten und Landkreisen. Danach sind im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr rund ein fünftel mehr Chinesen an Krebs gestorben. Als Gründe genannt werden Industrie-Abfälle aber auch Düngemittel und Pestizide aus der Landwirtschaft. Diese verschmutzten die Flüsse. Lungenkrebs entstehe vor allem durch Chemikalien, die in der Möbelherstellung eingesetzt werden. China ist größter Möbelhersteller der Welt. (18.05.2007) Rheinland-Pfalz feiert 60 Jahre Geburtstag und SWR4 hat das Geburtstagsgeschenk gepackt: Mary Roos, Guildo Horn und Marianne Rosenberg. Sie alle treten auf dem Ernst- (18.05.2007) Heute startet um halb Drei das große Landesfest zum 60. Geburtstag von Rheinland-Pfalz. Schon seit vier Tagen sind Techniker damit beschäftigt, die große SWR4-Bühne auf dem Ernst-Ludwig-Platz an der Großen Bleiche aufzubauen. Und die Bühne Modell Konzertmuschel muss heute ganz schön viel tragen: Der Belastungstest startet mit einer Trommlergruppe aus Ruanda, später kommen die drei besten Chöre des SWR4-Chorwettbewerbs "Rheinland-Pfalz singt mit". Und am Abend tritt auch Guildo Horn auf. Er ist ja bekannt dafür, dass er Bühnenkonstruktionen zum Kletterbaum umfunktioniert. Das lässt den Bühnenmeister, olli Korisch, aber völlig kalt: "Wenn er hinunterfällt, ist das sein Problem. Die Bühne steht." Die Stabilität bleibt also gewährleistet. Schließlich sind in der Bühne 15 Tonnen Aluminium verbaut. Ein Großteil davon verschwindet im Dach. Aber das werden die Gäste dieser Riesengeburtstagsparty wohl gar nicht brauchen. Denn der Blick in den Himmel verrät: Heute wird strahlendes Rheinland-Pfalz-Party-Wetter. Und die Party richtig anheizen werden Mary Roos und Marianne Rosenberg. In deren Garderoben im Abgeordnetenhaus überprüft Wolfgang Vogel, ob der Sekt für die Stars die richtige Temperatur hat. Draußen bleiben schon die ersten Schaulustigen stehen. Drei Stunden müssen sich die Gäste der großen Rheinland-Pfalz-Geburtstagsparty noch gedulden. Um halb drei eröffnet Ministerpräsident Kurt und Landtagspräsident Joachim Mertes das Fest. Der Eintritt ist frei. Petrus ist Pfälzer. Denn nach der verregneten Woche hat heute der Himmel aufgeklart. Und es ist das perfekte Partywetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu feucht. Und auch nicht zu trocken. Ja, hier um den Ernst-Ludwig-Platz herum haben schon die ersten Weinstände aufgemacht, kleine Lauben mit grünen Dächern. Man bleibt also nicht auf dem trockenen. Das haben auch schon ein paar Schaulustige erkannt. Die schauen mit dem Weinglas in der Hand auf die große SWR4-Bühne. Und die ist schon ein Augenschmaus für sich: Es ist nämlich eine haushohe Konzertmuschel mit einem leicht geschwungenen Dach. Aber wir sind ja nicht wegen der Bühne da, sondern wegen der Stars, die auf ihr spielen. Und da konnten wir heute schon Marianne Rosenberg sehen und hören: Atmo Gespannt bin ich auf die Lichtshow, die das Konzert unterstützen wird. Vorhin beim Soundcheck hat da auch schon ab und an was aufgeleuchtet. Jetzt am helllichten Tag kann man das noch nicht richtig sehen, aber wenn es heute Abend ein wenig dunkler wird – oh là là. Ich bin auch gespannt, welchen Fummel Guildo Horn anhaben wird..."
(17.05.2007) Es ist ein riesen Paket. Und jeder kann es mit auspacken! Denn der Eintritt ist frei! Heute um halb drei geht es los. Dann startet das Bürgerfest mitten im Mainzer Regierungsviertel. Ministerpräsident Kurt Beck und Landtagspräsident Joachim Mertes eröffnen das Fest. Dann gibt’s Musik und Shows von Einrichtungen und Organisationen aus ganz Rheinland-Pfalz. Es wird ein richtig pralles Programm geben, ist Regierungssprecher Walter Schumacher stolz. Stolz werden auch die drei Chöre sein, die sich für das Finale des SWR4-Wettbewerbs "Rheinland-Pfalz singt mit" qualifiziert haben. Ab 19 Uhr werden sie live Ihre ganz persönliche Liebeserklärung an Rheinland-Pfalz vortragen. Wer am besten singt und den ersten Platz belegt, entscheidet eine hochkarätige Jury. Mitglied dieser Jury ist auch Mary Roos. Nachdem sie die Chöre ihrem musikalischen Ohr unterzogen hat, wird Mary Roos die Wertungstafel ins Mikrofon eintauschen und ihre größten Hits zum Besten geben. Und Rheinland-Pfalz übt schon das Mitsingen. Und falls Liebe lähmt hilft Guildo Horn mit seiner Band namens orthopädische Stützstrümpfe. Vielleicht testen dann die Musiker die Bühne auf ihre Standhaftigkeit. Denn der in Trier geborene Horn ist dafür bekannt, bei Piep, piep, piep die Traverse hochzuklettern. Darauf freut sich schon SWR4-Moderator Nick Benjamin, der Landesfest-Conférencier: „Guildo Horn muss man von der Leine lassen. Ich freue mich, wenn er da ist, weil er sehr quirlig ist, weil er auch gute Ideen hat. Und ja, Leine darf er gar nicht haben. Wenn er da hochkrackseln will, das ist ne Sache des Sicherheitsingenieurs. Ich würde sagen bei Guildo Horn: Das ist ein Fass, da ziehe ich nur den Korken ab und dann springe ich zur Seite.“ Die Stimmung muss kochen, wenn Marianne Rosenberg auftritt. Denn sie stammt als einzige Künstlerin des Abends nicht aus Rheinland-Pfalz sondern aus Berlin. Also: Rheinland-Pfalz muss zeigen, heute steppt nicht nur der Bär, sondern bei dieser Geburtstagsparty fliegt die Kuh."
(11.05.2007) In die Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden fließen in den kommenden vier Jahren rund 180 Milliarden Euro mehr als erwartet. Der Grund: die Konjunktur. Gut die Hälfte des Geldes geht an den Bund. Mit dem unerwarteten Geldregen will Bundesfinanzminister Steinbrück die Neuverschuldung Deutschlands stoppen. In vier Jahren gebe es einen ausgeglichenen Haushalt, sagte Steinbrück bei der Veröffentlichung der Steuerschätzung in Berlin. Mit dem ausgeglichenen Haushalt ergebe sich eine historische Trendwende. Denn endlich könne mit dem Abbau des Schuldenbergs in Höhe von 1,5 Billionen Euro begonnen werden, erklärte Steinbrück. Doch der unerwartete Steuersegen weckt Begehrlichkeiten - besonders bei der SPD: Partei-Chef Beck möchte einen Teil des Geldes auch für Bildung, Familie, Klimaschutz und die Bundeswehr ausgeben. SPD-Fraktionschef Struck verlangt mehr Geld für die Sanierung öffentlicher Gebäude, Verkehrsminister Tiefensee mehr für Bahn und Straßen. Steinbrück scheint dem nicht abgeneigt: Es gebe finanzpolitische Spielräume. Zwei Milliarden "vom frischen Geld", wie er es nannte, könnten in andere Bereiche fließen. Der Haushaltsplan für nächstes Jahr wird in den kommenden Wochen aufgestellt und soll Ende Juni im Kabinett beschlossen werden."
(11.05.2007) In Berlin stellen die Politiker heute ein Programm vor, dass Deutschland verschlanken soll. Und das in einem fünf Punkte-Plan. Mit ihrem Fünf-Punkte-Plan «Fit statt fett» will die Regierung die Ernährung und das Bewegungsverhalten der Deutschen bis 2020 nachhaltig verbessern und vor allem den Trend zum Übergewicht bei Kindern stoppen. Dick im Blick. Und das mit einem zwinkernden Auge. Die Deutschen sind in Europa wieder mal auf Platz eins – beim Übergewicht. Deutschland ist voll fett. Und richtig dick oben mit dabei. Vor allem die deutschen Männer! Fast dreiviertel von ihnen hat zuviel auf den Rippen, sagt das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaft. Bei den Frauen sieht’s auch nicht dünner aus: Für gut die Hälfte hat der Begriff Übergröße Wahrheitscharakter. Frau schreit Einen Schrecken hat auch Gesundheitsministerin Schmidt bekommen: Die Kosten für ernährungsbedingte Krankheiten belaufen sich mittlerweile auf rund 70 Milliarden Euro im Jahr! Das ist ein drittel aller Gesundheitskosten. Ganz schön viel, dachte sich Ulla Schmidt und traf sich mit einem Kollegen, der sich mit Übergewichtigen auskennt: Ernährungsminister Seehofer. Das Ergebnis: Nicht FdH für Friss die Hälfte sondern FsF ist das neue Programm gegen zuviel Ballast: Fit statt Fett – der fünf Punkte schlanke Aktionsplan. Ulla Schmidt: „Bewegen, bewegen, Das ist das wichtigste, um gesund zu bleiben“ Für bewegungsfaule Dicke gilt: Selbsterkenntnis - der erste Weg zur Besserung. Also berechnen Sie ihren persönlichen Body-Mass-Index. Körpergewicht in Kilogramm ... geteilt durch Größe in Metern im Quadrat. Mein Tipp speziell für Sie: Machen Sie sich dabei ruhig etwas größer. Und vergessen Sie nicht: Sie haben meistens Kleider an wenn Sie sich wiegen! Ziehen Sie also locker mal 10 bis 20 Prozent ab von dem, was die Waage anzeigt. Ja. Das sind alles Kilo! Auf jeden Fall: Werden Sie sich ihres Körpers bewusst! Denken Sie an die Kilo nicht nur mit ihren Hirn- sondern auch mit ihren Fettzellen. Und denken Sie immer daran: „Bewegen, bewegen, Das ist das wichtigste, um gesund zu bleiben“
(10.05.2007) Die Krise der Telekom spitzt sich weiter zu: Ab Morgen treten rund 10 000 Telekom-Mitarbeiter in den Streik. Sie sind dagegen, dass am 1. Juli 50 000 ihrer Kollegen in neue Service-Gesellschaften ausgelagert werden. Für diese Mitarbeiter hieße das weniger Verdienst bei gleichzeitig mehr Arbeit. Vor diesem Hintergrund ist die Bereitschaft zum Arbeitskampf entsprechend hoch. 96,5 Prozent der Mitarbeiter haben für den Streik gestimmt, so die Gewerkschaft Verdi nach der Urabstimmung. Bundesvorstand Lothar Schröder sagte, Verdi sei auf einen Arbeitskampf vorbereitet, der sich über mehrere Wochen hinziehen könne. Es ist der erste große Telekom-Streik seit der Privatisierung des Unternehmens vor zwölf Jahren. Betroffen werden davon vor allem Geschäftskunden sein. Aber auch bei Privatkunden dürfte es Probleme geben, denn Störungsbeseitigung, Neuanschlüsse und Ummeldungen werden sich hinauszögern. Telekom-Chef René Obermann musste heute die schlechten Quartalszahlen bestätigen, die schon vorher an die Öffentlichkeit gedrungen waren: Rund 600 000 Kunden kündigten ihre Verträge. Die Telekom hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Überschuss halbierte sich im Das ist nur ein Blick in die beiden Lager des bevorstehenden Arbeitskampfes bei der Telekom. Der Streik wird dem ehemaligen Staatsunternehmen weitere Verluste bringen.
(08.05.2007) Bundespräsident Horst Köhler gewährt dem früheren RAF-Terroristen Christian Klar keine Gnade. Klar ist mittlerweile 54 Jahre alt. Er sitzt fast ein Vierteljahrhundert hinter den Gittern der JVA Bruchsal. Und es kommen noch eineinhalb Jahre dazu. Der Sohn eines Lehrerehepaars gehörte zur zweiten RAF-Generation und war Ende der 70er Jahre einer der führenden Köpfe der Roten Armee Fraktion. Eine Chronik über den Lebensweg von Christian Klar in den vergangenen 30 Jahren. 7. April 1977 2. April 1985 22. November 2001 23. April 2007 24. April 2007 4. Mai 2007 7. Mai 2007 (07.05.2007) In Mainz soll ein neues Kohlekraftwerk entstehen. Betreiber ist die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, kurz KMW. Die KMW ist ein Tochterunternehmen der drei regionalen Energieversorger Stadtwerke Mainz, Stadtwerke Wiesbaden und der Heag Südhessiche Energie mit Sitz in Darmstadt. Einzelheiten zum neuen Kraftwerk, das fast eine Milliarde Euro kosten soll. Das neue Steinkohlekraftwerk auf der Ingelheimer Aue leistet rund 800 Megawatt. Der Wirkungsgrad liegt bei 46 Prozent. Das heißt: Fast die Hälfte der zugeführten Energie wird in Strom umgewandelt. Damit liegt das Kohlekraftwerk weit über dem Durchschnitt der deutschen Kohlekraftwerke und gehört zu den modernsten der Welt, sagen die Betreiber. Es schaffe 100 neue Arbeitsplätze und sichere die 350 bestehenden. 940 Millionen Euro soll das Kraftwerk kosten und in fünf Jahren ans Netz gehen. Befeuert wird es mit so genannter Importkohle zum Beispiel aus Südamerika oder Asien. Diese Kohle ist deutlich billiger. Gegenüber Gas bestehe auch eine größere Liefersicherheit. Der Nachteil: In der Kohle steckt mehr Kohlendioxid. Bei gleicher Leistung wird sich der CO2-Ausstoß gegenüber Gas mehr als verdoppeln. Im neuen Steinkohlekraftwerk auf der Ingelheimer Aue entstehen dann 3,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Das ist zehn Mal mehr als in einem Atomkraftwerk mit vergleichbarer Leistung.
(04.05.2007) Pudel im Woll-Kostüm, Möpse im Lederriemengestell und der klassische deutsche Schäferhund. Die Schönsten der Schönen auf vier Pfoten stellen ihre Körper zur Schau. Davor sitzen ältere Damen und Herren in Campingstühlen und unterziehen 6 000 Rassehunde mit gestrengem Blick ihrer Kritik. Absoluter Höhepunkt beim sogenannten Hundegipfel ist die Wahl zum schönsten Zuchthund Europas. Für den Gewinner haben sich dann alle Anstrengungen und Investitionen gelohnt. Überhaupt investiert der Deutsche eine Menge in seine Lieblinge. Drei Milliarden Euro. Soviel wünscht sich Umweltminister Sigmar Gabriel für den Klimaschutz; soviel wünscht sich Familienministerin Ursula von der Leyen für Kinderkrippen. Aber wofür geben die geneigten Wähler drei Milliarden Euro aus? Für die Katz. Oder für den Hund. Ja, die Deutschen investieren jährlich drei Milliarden in Bello, Miezi und Horst den Pagagei! HORST, DER PAPAGEI, KRÄHT Schließlich soll es den gefiederten und gepellzten Gefährten auch gut gehen. Denn nur so bekommt Frauchen oder Herrchen von ihnen auch was zurück. Geht’s dem Haustier gut, hat das eine positive psychologische Wirkung auf den Menschen, sagen die Verhaltensforscher. Hunde glänzen wegen ihres emotionalen Verhaltens und werden als sogenannte ‚Therapiehunde’ eingesetzt, um Patienten aufzuheitern. Und Katzenfell hilft bei Rheuma. DIE KATZE SCHREIT Die drei Milliarden Euro für deutsche Haustiere entlasten also das Gesundheitswesen. Deshalb überlegen Sie mal: Beim nächsten Krankenbesuch: Bringen Sie einen süßen Hamster mit ans Krankenbett. Oder doch einen Strauß Schnittblumen? Ach, und im übrigen: Für Schnittblumen geben die Deutschen auch 3 Milliarden Euro im Jahr aus. Aber: Schnittblumen halten selten mehr zwei Wochen, Hamster in der Regel zwei Jahre. Der Begriff Hamsterkauf bekommt eine ganze neue Dimension: Drei Milliarden Euro werden in Deutschland für Haustiere ausgegeben, und das ist vor allem eine Investition in das Seelenheil."
(19.04.2007) Es war einmal. In Lothringen. Ein kleines Mädchen leidet unter der Tyrannei seines Vaters, einem Offizier. Es ist keine schöne Kindheit für Sego und ihre sieben Geschwister, auch nicht später im Internat einer Klosterschule: Strikter Gehorsam ist wichtiger als Spielen und Freie Entfaltung. Sego spürt den Ernst des Lebens sehr früh. Sehr schnell wird aus der kleinen Sego die Frau Segolene. Aber: Ihre Zielstrebigkeit öffnet ihr die Pforten zur Eliteschule Ö. N. A, einer Politikerschmiede. Dort lernt sie ihren Mann kennen, der Pforten öffnen kann: die zum Beraterkreis des ehemaligen französischen Präsidenten Mitterand, dann die zum Amt der Familienministerin und schließlich die Ernennung zur Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten. Verheiratet, vier Kinder. Alles deutet auf ein glückliches Ende hin. Und den Elysee-Palast. (19.04.2007) Für die Kirchen seien es bedauerliche Zahlen, sagt der Leiter des Statistikamts, Joachim Eicken. Zwar treten weniger Menschen aus der evangelischen oder katholischen Kirche aktiv aus. Aber dadurch, dass immer mehr Menschen ins Umland der Stadt ziehen, gibt es weniger Kirchenmitglieder in Stuttgart selbst. Vor 30 Jahren gehörten 80 Prozent einer Kirchengemeinde an, mittlerweile nur noch 57 Prozent. Auch der Zuzug von Menschen aus Ostdeutschland oder dem Ausland kann diesen Trend nicht stoppen. Und weil immer weniger Kinder geboren werden, fehlt es schlicht an Nachwuchs. Deshalb zeichnet Eicken auch ein düsteres Bild für die Zukunft der beiden großen Volks-Kirchen. Und damit verbunden auch für die Stadt: Denn mit weniger Mitgliedern haben die Kirchen auch weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer. Die Folge: Kirchen-Gemeinden, aber auch soziale Einrichtungen schließen. Davon werden dann auch die Stuttgarter ohne Kirchenzugehörigkeit betroffen sein, wenn zum Beispiel die katholische Suchtberatungsstelle oder der evangelische Kindergarten nicht mehr existiert.
(26.03.2007) Der 26-jährige Diplom-Verwaltungswirt und bisherige Bauamtsleiter der Gemeinde wiederholte sein gutes Abschneiden im ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Damals verpasste er die absolute Mehrheit mit nur 44 Stimmen. Den entscheidenden Wahlgang gestern gewann er aber mit 70,44 Prozent deutlich. Sein stärkster Konkurrent Manfred Kleile erreichte knapp 28 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. Die Wähler aus den Teilgemeinden Engelsbrand, Grundbach und Salmbach zeigten mit ihrer Wahl, dass sie auch einem jungen Kandidaten erfolgreiche acht Jahre im Amt des Bürgermeisters zutrauen. Wenn Rosenau sein Amt am 15. Mai antritt, wird er mit 26 Jahren zum jüngsten amtierenden Bürgermeister in Baden-Württemberg. Bisher führte diesen Titel der nur wenig ältere Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf im Ortenaukreis. (bis hier 50 Sekunden) (05.11.2006) Mit Mönchskutte und Sandalen hat der Synodale, der Teilnehmer der Synode, nicht viel zu tun. Anzug und Krawatte trägt der moderne Kirchenmann von heute. Aber: Im Würzburger Kongresszentrum beschäftigt er sich mit Armut. "Gerechtigkeit erhöht ein Volk – Armut und Reichtum" lautet der Schwerpunkt der Synode. Die selbst-gesteckten Ziele der Teilnehmer sind hoch. (04.10.2004) Man kann sie beneiden! Um die 60 und noch immer so fit, dass sie ein dreistündiges Pop-Konzert geben können, bei dem es kräftig rockt: Status Quo und Manfred Mann's Earthband spielten in Karlsruhe. Status Quo: Vierzig Jahre im Musikgeschäft. 112 Millionen verkaufte Platten. Und das alles mit nur drei Akkorden. Die Fans lieben sie dafür. Die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe: ausverkauft. Access all Areas heißt die Tour, die mittlerweile 52. Vor weißen, haushohen Lautsprechertürmen zeigen die beiden Frontmänner Francis Rossi, Vater von acht Kindern, und Rick Parfitt, ungeachtet seines vierfachen Beipasses, wie man die Gitarre richtig spielt. Quo, wie Fans die Band nennen, feuern all’ ihre Hits ab wie Down Down, Rockin all over the World oder Forty Five Hundered Times. Special Guest auf der Acess-All-Areas-Tour ist Manfred Manns Earthband. Manfred Mann - mittlerweile 63 Jahre alt – war sein Alter nicht anzumerken. Hits wie Blinded by the light lassen die 70er Jahre wieder aufleben. Drei Stunden spielten Quo und Manfred Mann. Spätestens nach der Hälfte genierte sich niemand mehr, die Bands mit der Luftgitarre zu begleiten. Am 16. Oktober kommen die beiden Bands nach Stuttgart in die Liederhalle.
(30.07.2004) VP1 E-Mail ist toll, weil... (29.07.2004) Schon vor 300.000 Jahren wurde gegrillt, das beweisen versteinerte Fleischreste in der Holzkohle alter Feuerstellen bei Peking und in Frankreich. Damals gab es Elche und Nashörner, bei den Ägyptern Hyänen und Krokodile. Die Römern tischten die erste Bratwurst auf. Und was liegt heute auf dem Rost? (26.07.2004) Zum Reisewochenende erwartet der ADAC viel Stau. Den haben wir uns aus der Luft angeschaut.
(21.07.2004) Wenn es nicht regnet, heißt es Straßenkampf in Karlsruhe. 200 Pferdestärken gegen die Kraft aus zwei Waden. Benzin gegen Kalorien. Oft genug gibt’s Wutausbrüche. (20.07.2004) Eine Expedition zu Saurierausgrabungen in mitten von Mexiko. Das war der Hauptpreis einer ganz besonderen Gewinnspiel: Das Bürgerbüro verloste die dreiwöchige Reise an seinem Stand auf dem Stadtgeburtstag unter allen Studenten, die ihren Erstwohnsitz in Karlsruhe anmeldeten. Und nicht zu vergessen: Für die Kommune lohnt es sich auch finanziell: 1067 Euro bekommt die Stadt für jeden Studenten, der hier seinen Erstwohnsitz anmeldet. Doch die Akademiker sind nicht meldefaul. Sie haben ihre Gründe, ihren Erstwohnsitz nicht in Karlsruhe zu melden. Anreize müssen her. Doch bisher lockte die Stadt nur mit einem kleinen Begrüßungspaket. Inhalt: Ein Kulturscheckheft mit Infos über die Theater, Museen und Kulturzentren. Für Studenten zu reizlos. Doch zum neuen Semester soll alles besser werden. Unter dem Motto Wer ist schon gerne zweiter - Bekenne Dich zu Karlsruhe wird man die Reingeschmeckten vor Ort in den Studienbüros und Mensen beraten. So viel Geld jeder Student auch dem Stadtsäckel bringt: Zwingen, sich umzumelden, will man niemanden. Andere Städte erheben Zweitwohnsitzsteuern oder erschweren den Zugang zu Wohnheimen. Davon will man in Karlsruhe aber die Finger lassen.
(15.07.2004) ATMO Füße über Splitter (15.07.2004) ATMO Zack, Zack, (07.07.2004) In der vergangenen Woche wurde im Bruchsaler Forst eine 36 jährige Frau sexuell belästigt. Das war der mittlerweile 18. Fall in der Region. Gefasst ist der Täter noch nicht. Die Polizei geht jetzt aber davon aus, dass es sich um einen Serientäter handelt. Denn seit April 2000 habe ein Mann mehrere Frauen und Mädchen sexuell belästigt. Zuletzt entging im Juni vor einem Jahr eine Joggerin am Pfinzentlastungskanal nur knapp einer Vergewaltigung. Alle Vorfälle ähneln sich, kann jetzt Jürgen Schofer vom Polizeipräsidium Karlsruhe vermelden. Die 41-jährige Joggerin aus Forst konnte sich durch mutiges Verhalten aus ihrer Notsituation befreien. Doch die Polizei bittet verstärkt darum, mehrere Vorsichtmaßnahmen zu treffen, bevor man als Frau im Wald alleine unterwegs sein will. Dass die Gewaltbereitschaft des Täters in den vier Jahren stetig zugenommen hat, bereitet der Polizei große Sorge. Zur Zeit kontrolliert sie verstärkt die Waldgebiete im Raum Karlsruhe.
(10.01.2001) Seit Jahrzehnten rotieren beim Burda-Verlag in Offenburg die Druckmaschinen. Hier wird gedruckt, was die Matrizen hergeben. 160 Titel verlegt Burda weltweit. Nach eigenen Angaben kann Burda so knapp 30 Millionen Menschen erreichen. Firmenchef Hubert Burda verfolgt immer ein Ziel. In den Magazinen soll das stehen, was die gemeinen Leute interessiert. Im Internet preist der Verlag seine Magazine an. Etwa Focus, das sich mit Spiegel und Stern mittlerweile eine Schlacht um die verkaufte Auflage liefert. Im Internet heißt es über Focus: (Flo Nimis - wie ein Fischverkäufer anpreisend:) Verkaufte Auflage: 750 000 Exemplare in der Woche. Über viermal so oft verkauft sich die Bunte. Vier Millionen Mal geht das Heft mit Klatsch und Tratsch über die Ladentheke. Auch hier erklärt Burda im Internet, was den Erfolg der Bunten ausmacht: rauchige Damenstimme - affektiert: Dabei zieht Burda mit dem allgemeinen Trend im Medienmarkt gleich: Die Auflagen der großen Hefte fallen, Spartenmagazine sprießen aus dem Boden. Wer glaubt, seit es Internet und Multimedia gebe, verlieren die Printmedien an Bedeutung - der irrt. Im letzten Jahr gab es soviele Neuerscheinungen im Printbereich wie nie zuvor. In den letzten zehn Jahren hat sich so die Zahl der Titel verdoppelt - auf mehr als 4 000 Zeitschriften. Oton: Vivian ist... Chefin Print X, Chefredakteurin der Vivian-Redaktion, erklärt dann in einer Pressekonferenz, was genau im Magazin stehen wird. Das Magazin spiegle die Interessen der modernen, selbstbewussten Frau wider: Wie sieht das schönste Handy aus, wie kann man das Handy am Strand bedienen. Diese Tipps hat die Redaktion in München für ihre Leserinnen parat. Und weil für die moderne Frau diese wichtigen Informationen jederzeit abbrufbar sein sollten, erscheint Vivian auch im Internet. Dort wird es einen Teil des Hefts als Online-Ausgabe geben. Und jede Frau, die auf der homepage surft, kann sich als Frau einer ganz besonderen Gattung ansehen, meint X, Chefredakteurin der Onlineredaktion Oton: Chefin online --> Vivi@ns werden das sein Hoffentlich bleiben den selbstbewußten Vivians jene Lügen erspart, die der Burda-Verlag in seinen anderen Frauen-Magazinen verbreitete. So musste sich das Klatsch-Magazin Bunte mehrere Male vor Gericht verantworten, wegen Veröffentlichung erfundener Interviews oder fingierte Stories um Prominente. Verhandlungen in allen Instanzen folgten. Danach ließ sich der Verlag nicht mal von Gerichturteilen einschüchtern. Das alles liegt in der Vergangenheit von Bunte. Mit dem neuen Magazin Vivian wird das vielleicht anders. Vielleicht gehen die Vivian-Redakteurinnen auf dem Pfad der journalistischen Tugend. Aber der Druck auf sie wird stark sein: Burda will in der ersten Auflage 600 000 Exemplare absetzen. Der Start von Vivian ist noch unbekannt - irgendwann in diesem Jahr. "
(18.12.2000) Es gibt naturgegebene Feindschaften: Kain und Abel, Prinz August und die Presse, Beamten und Arbeit. Wobei auch immer Blut floss, dass waren die morgendlichen Besuche der Postboten. Denn oft sprangen sie Hunde an...Dem tritt die Bayrische Post jetzt entgegen. Mit versucht Selbstverteidigungskursen man, sich den Köter vom Leib zu halten Morgens acht Uhr. Mit dem gelben Postfahrrad fährt Erika Dutschinski die Post aus. Sie biegt in eine Nebenstraße ein. Gleich wird sie auf ihren Feind treffen. Schon mehrere Monate konnte sie sich mit ihm nicht anfreunden. Sie stellt ihr Fahrrad ab, nimmt die Briefe und schleicht sich langsam an den Gartenzaun. Der Briefkasten hängt gleich neben dem Gartentor. Doch sie wird schon erwartet. Zwei Augen mustern sie, dann setzt der Schäferhund zum Sprung an. Bisher bellte er nur. An diesem morgen springt er über den 1 Meter 20 hohen Gartenzaun und fällt die Postbotin an. Er beißt sie ins Bein und verursacht eine handgroße Fleischwunde. Zweieinhalb Wochen war Erika Dutschinski krankgeschrieben "Ich habe panische Angst.... gehe ich rückwärts" Rund 3 500 mal im Jahr kommt es zum Konflikt zwischen Postausträgern und Hunden. Die Männer und Frauen in Gelb ziehen dabei meist den kürzeren. Der Deutschen Post entstehen so Kosten in Höhe von 17 Mio Mark im Jahr - für Krankenhausaufenthalte, Ersatzpostboten und zerrissene Dienstkleidung. Jetzt beißt man zurück. Mit Selbstverteidigungskursen will man wieder Herr im Kampf ums Revier werden. Auge in Auge, Zahn um Zahn stehen die Seminarteilnehmer ihren Kontrahenten gegenüber und Hundeausbilder Kurt Husek erklärt, was im Fall der Fälle zu tun ist. "Ja der Hund läuft hier in der Gegend rum ... Fahrrad zwischen Hund und ihn selber" Das Gefühl für das Tier soll im Seminar geschärft werden, damit man beim nächsten Bellen ruhig Blut bewahrt. Doch woher kommt die Aversion des felligen Gesellen gegen den Postboten mit den Rechnungen? "Es liegt an vielen Dingen...saust dann dahinter" Hat den Hund dann der Jagdtrieb ereilt, muss der Postbote schnell handeln. Ist er mit dem Fahrrad unterwegs, kann er versuchen, das Rad mit dem Lenker hochzuheben und den Hund so zu vertreiben. Oder er hält sich das Tier mit seiner Posttasche vom Körper. Und für jeden Nicht-Postboten hat Kurt Husek auch einen beruhigenden Tipp: "Ruhig stehen bleiben...nur Reißwunde" Schäferhund Blacky war brav und tat nur das, was man ihm befahl. Diesmal war es noch eine Trockenübung, die die Postboten auf zukünftige Begegnungen vorbereiten sollte. Hoffentlich bewahren sie Ruhe, wenn das nächste Mal ein Wachhund mit lechzender Schnauze aus sie zurennt. "Teilnehmer sollten Situationen kennenlernen wünscht viel glück""
(14.12.2000) Jeden Donnerstag heißt es "Quer" im Fernsehen des Bayrischen Rundfumks. Immer um 20 Uhr 15 beschäftigt man sich damit, was geht schief im Freistaat, welche Fehler erlauben sich die CSU-ler, was stört die dörfliche Eintracht der Ober- und Unterbayern. Eine dreiviertelstunde wird dem Zuschauer Einblick in die südostdeutsche Mentalität gewährt. Ankerman der Sendung ist der Kabarettist Christoph Süß. Seit zwei Jahren moderiert er die Sendung. Oton: "Es ist eine regionale Sendung ..... gar bizarre Dinge." Bizzarre Dinge, da bietet sich im größten Bundesland Deutschlands einiges. Die Querredaktion durchleuchtet die dubiosen Steuerangelegenheiten der Strauß-Familie oder erzählt die Geschichte der Gemeinde Burtenbach im Kreis Günzburg, die sich mit aller Gewalt einem Swinger-Club im einstigen Wirtshaus des Dorfs zu Wehr setzt. Oton: "Was war ihr liebster Fall? Jessasnah! Was ich mal sehr mochte waren Biberberater...hat mir was gegeben" Christoph Süß ist Kabarettist. Am Wochenende tourt er von Bühne zu Bühne durch ganz Deutschland, am Donnerstag ist er im Fernsehstudio in München. Dass es ihm Freude macht, die Zuschauer zum Nachdenken und Lachen zu bringen, merkt man ihm sofort an, wenn man ihn auf dem Bildschirm rumspringen sieht. Jeden Beitrag präsentiert er mit Pfiff und Humor. Zu jeder Sendung gehört auch dazu, dass er ein Zwiegespräch mit sich selbst führt. Einmal als Ritter Kunibert, als Napoleon, als Angehöriger der verwöhnten Generation X oder als Depressiver Intellektueller, der sich nicht mehr aus seinem Mülleimer traut. Oton "Das ist meine Idee ... das macht mich natürlich froh" Das eher linke Politmagazin Quer ist das Alibi für den erzkonservativen Bayrischen Rundfunk. Wer also Lust bekommen hat, Bayern einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben, der muss einschalten: Quer - immer Donnerstags, 20 Uhr 15 im Bayrischen Rundfunk."
(13.12.1999) Spiegel-Online schrieb im Mai 2001, einer „Hardcore-Gruppe“ von Radioenthusiasten sei es gelungen, unbeirrt von Prüfungsdruck und vorlesungsfreien Magerzeiten ein Programm am Leben zu halten, das auch innerhalb der Universität zu einer quicklebendigen Kommunikationsplattform geworden sei. „Auch an radiofonen Sternstunden mangelte es nicht. Wenn beispielsweise eine astrologiebegeisterte Angestellte einem fanatischen Naturwissenschaftler im Studio gegenübersitzt, der ihr ein ‚Vade retro‘" entgegenbrüllt.“ Diese Szene spielte sich ab in der Ausgabe „Astrologie: Wissenschaft oder Humbug“.
|
Im Magazin: 70 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund Auf dem Trittbrett Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird 70 und feiert das mit einem Festakt in Berlin. Die Freude trübt, dass nicht mal jeder fünfte Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Gesichtserkennung am Bahnhof Tag der Pressefreiheit
|
|||||
 | 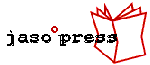 mehr JASO im jasoweb.de |